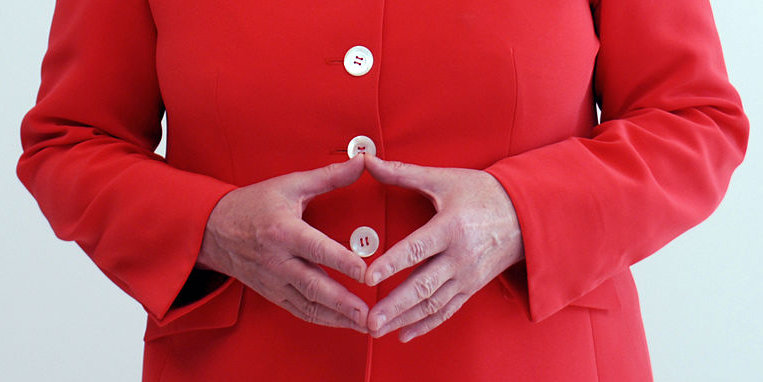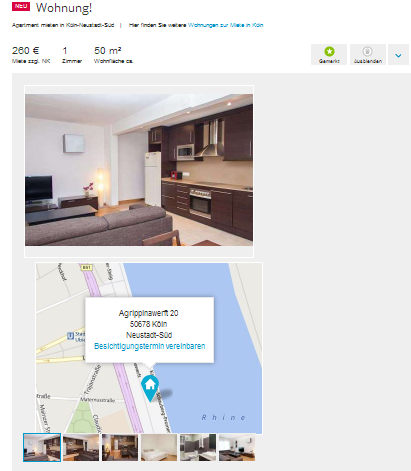Der Schildower Kreis hat in einer Pressemitteilung zum Tag der Menschenrechte einmal mehr die kopflose Drogenpolitik, wie sie derzeit praktiziert wird, angeprangert. Der Schildower Kreis will auf die schädlichen Folgen der Drogenprohibition aufmerksam machen und legale Alternativen zur repressiven Drogenpolitik aufzeigen. Der Schildower Kreis fordert von den Verantwortlichen eine alternative Drogenpolitik und eine ideologiefreie und wissenschaftliche Überprüfung von Schaden und Nutzen der aktuellen Drogenpolitik.
In der Pressemitteilung heißt es: „Systematische Menschenrechtsverletzungen werden global mit dem Kampf gegen Drogen legitimiert. […] Im Jahre 2014 wurden ungezählte Menschen von einer Justiz umgebracht, die für die Menschenrechte derjenigen, die mit kriminalisierten Drogen handeln, kein Gespür hat. Am Tag der Menschenrechte 2014 sollte es erlaubt sein zu fragen, warum die Menschenrechts-Deklarationen nicht verhindern konnten, dass zwei Brüderpaare in Saudi-Arabien wegen der Einfuhr „großer Mengen“ Cannabis ganz formgerecht und öffentlich die Köpfe abgeschlagen wurden. Derlei war, wenn man den Historikern glauben darf, im Osmanischen Reich bei Tabak-Händlern und Tabak-Rauchern üblich gewesen. Manchmal aber scheint die Zeit stehen geblieben: 500 Jahre vergehen – und immer noch wird Menschen der Kopf abgeschlagen, weil sie mit Substanzen handeln, die andere Menschen ganz einfach für ihren eigenen Genuss erwerben wollen. Man muss nicht Drogengenuss gut finden, um es richtig zu finden, dass auch für Drogengebrauchende die Menschenrechte gelten.
Saudi-Arabien ist ein Land der „westlichen Welt“, auf das der Westen großen Einfluss haben sollte. Wer, wenn nicht die Hauptstädte der westlichen Welt, wäre in der Lage, den Herrschern in Saudi-Arabien einen Dialog über die Menschenrechte anzubieten? Ein solcher Rechtsstaatsdialog wäre freilich auch andernorts vonnöten. Etwa im Iran, in Vietnam und natürlich in China. Zu dem ganz offiziellen Töten kommen noch zahllose Fälle von extralegalen Hinrichtungen, bei denen Menschen als vermeintliche Drogenkonsumenten oder Dealer von Polizei, Militär oder Kriminellen getötet werden. Thailand, Mexiko und Kolumbien sind dabei nur die Spitzenreiter von zielgerichteten Morden im Namen eines irrationalen Krieges gegen „das Böse“.
Eine Untersuchung der internationalen Menschenrechtsorganisation Koordinationsstelle Kolumbien-Europa-USA (CCEEU) kam zu dem Schluss, dass die US-Militärhilfe zur Drogenbekämpfung in Kolumbien einen signifikanten Anstieg von statistisch erfassten außergerichtlichen Hinrichtungen bewirkt. Wo im Namen der Drogenbekämpfung nicht getötet wird, da raubt ein regelrechter Narco-Gulag Freiheit, Gesundheit und Würde ungezählter Menschen. Unerwünschte Personen werden in Drogenzentren interniert und misshandelt. Oft verschwinden sie ohne Rechtsgrundlage auf Grund willkürlicher Verhaftungen und sind für Monate oder Jahre Folter und Zwangsarbeit ausgesetzt. In speziellen Haftzentren für Drogenabhängige, wie es sie in China, Laos, Kambodscha und Vietnam gibt, kommt es regelmäßig zu physischen Misshandlungen und Zwangsarbeit ist die Regel. Derlei Arbeitslager werden vom freien Westen nicht nur geduldet. Die Regierung der USA, das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) und andere internationale Geldgeber sind zum Teil direkt beteiligt.
Die UNO befindet sich mit ihrer deutlichen Festlegung auf eine Politik der Prohibition in einem Dilemma. Einerseits will sie Drogenmissbrauch bekämpfen, andererseits unterstützt sie mit ihrer Position weltweit Krieg, massive Menschenrechtsverletzungen, Rassismus und ganz generell den Abbau demokratischer Rechte. Dies wird besonders deutlich bei der Betrachtung der Haltung des International Narcotics Control Boards (INCB), welches Liberalisierungen der Drogenpolitik in Mitgliedsländern generell kritisiert und dazu auch seine vertraglich festgelegten Kompetenzen überschreitet, sich aber gleichzeitig einer deutlichen Ablehnung der Todesstrafe verweigert.
Das erklärte Ziel der UN und der demokratischen Staaten, die Todesstrafe zu ächten, wird durch eine Drogenpolitik ad absurdum geführt, die andererseits systematische und grausamste Menschenrechtsverletzungen legitimiert.
Menschenrechte gehören in die Drogenpolitik – in Europa und in allen Staaten unserer Erde. EU-Parlament und UN müssen endlich in diese Richtung handeln und auch in bilateralem Kontakt mit den entsprechenden Staaten Auf eine Änderung drängen. Alle demokratischen Staaten, die EU und alle Einrichtungen der UN müssen jegliche finanzielle, polizeiliche und logistische Unterstützung von Staaten einstellen, die bei der sog. Drogenbekämpfung die Menschenrechte missachten.
Bei der internationalen Beobachtung der globalen Drogensituation, durch EU oder dem UNODC, müssen Menschenrechtsaspekte künftig eine wesentliche Rolle spielen. Todesstrafe, Folter und Internierung dürfen als Formen der Drogenpolitik nicht länger akzeptiert werden. Letztlich führt kein Weg daran vorbei, das System der Prohibition zu überwinden, wenn man effektiv und nachhaltig die globale Menschenrechtssituation verbessern will.
Beenden wir die kopflose Drogenpolitik: jetzt!“
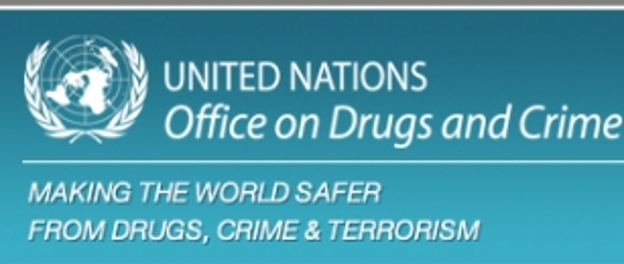
Bis in dieses Jahrzehnt hinein hat es die UNO, insbesondere der UN-Drogenbehörde UNODC nicht gestört, wenn im Zusammenhang mit angeblicher Drogenbekämpfung Bürgerkriege, systematische Menschenrechtsverletzungen und ökologische Zerstörung zugenommen haben. Noch 2012 hat die UNO den Kampf des Iran gegen den Drogenschmuggel ausdrücklich gewürdigt, obwohl hinreichend bekannt war, dass dieses Land bei der Drogenbekämpfung rechtsstaatliche Standards vermissen lässt. Geständnisse werden durchaus mit Folter erpresst, politischen Gegnern schon mal Drogen untergeschoben. Die Anwendung der Todessstrafe bei Drogendelikten hat nicht nur im Iran, sondern auch in Ländern wie Vietnam oder Saudi-Arabien eine Dimension erreicht, die an Staatsterror grenzt.
Systematische staatliche Gewalt gegen die Beteiligten des illegalisierten Drogenmarktes nimmt global Züge von „Säuberungsaktionen“ an, wie wir sie aus dem Bereich ethnischer, religiöser, politischer oder homophober „Säuberungen“ kennen.
Inzwischen hört man von den UN-Drogenbehörden neue, früher kaum vorstellbare, Töne. Während des 57. Treffens der Suchtstoffkommission, das vom 13. bis 21. März 2014 in Wien stattfand, hat der UNODC Frontmann Yury Fedotov (Leiter des UN-Ministeriums für Drogen und Kriminalität) verkündet: „Die Vereinten Nationen sollen für ihre Mitgliedsstaaten keine Zwangsjacke sein, und Abkommen zur Drogenkontrolle stellen keine Sanktionen bereit. Sie sind auf den Prinzipien des guten Willens und des Einverständnisses mit internationalen Gesetzen aufgebaut. Es liegt an jeder Regierung selbst, zu entscheiden, ob sie Festlegungen internationaler Gesetze folgen oder nicht folgen wollen.“
Am 14. März 2014 hat eine Arbeitsgruppe des UNO-Büros zur Drogen und Verbrechensbekämpfung angekündigt, grundlegend neue Empfehlungen auszusprechen, welche die Strafverfolgung für Drogengebrauch in Frage stellt. Die wissenschaftliche Beratergruppe zu Drogenpolitik, Gesundheit und Menschenrechte des UNODC – unter anderem Nora Volkow, Vorsitzende des Nationalen Instituts gegen Drogenmissbrauch (NIDA) der USA – haben ihre Empfehlungen auf dem High Level Meeting der 57. Internationalen Suchtstoffkonferenz vorgestellt. Die Empfehlungen der Arbeitsgruppe sagen, dass strafrechtliche Verfolgung nicht hilfreich sei.
Am 26. Juni 2014, als der Weltdrogenbericht (2014 World Drug Report) in Wien der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, mahnte Yury Fedotov in der an diesem Tag veröffentlichten Pressemitteilung an, einen stärkeren Fokus auf die Gesundheit und die Menschenrechte von Drogengebrauchern zu richten. Ebenso forderte er, dass kontrollierte Substanzen (in Deutschland Betäubungsmittel im Sinne des Gesetzes) vermehrt für den medizinischen Gebrauch verfügbar gemacht werden sollten. Und zum heutigen Tag der Menschenrechte erklärte das UNODC in einer Pressemitteilung, dass man sich in den eigenen Aktivitäten weiterhin dafür einsetzen werde, dass jedes Individuum mit Respekt und im Einklang mit internationalen Menschenrechtsstandards behandelt wird.
In Sachen Drogenpolitik ist Deutschland derzeit eine Festung der Ignoranz. Dies stellte Wolfgang Nešković, ehemaliger Richter am Bundesgerichtshof, anlässlich einer Podiumsdiskusion am 6. Dezember 2014 im Hanf Museum in Berlin fest. Er begründete dies unter anderem mit der Tatsache, dass die Parteien der großen Koalition, CDU, CSU und SPD, sich einer Evaluierung ihrer Drogenpolitik verweigern.
In einer Resolution deutscher Strafrechtsprofessorinnen und –professoren an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages wurde die Notwendigkeit der Überprüfung der Wirksamkeit des Betäubungsmittelgesetzes festgestellt. In der von inzwischen 130 Strafrechtsprofessorinnen und –professoren unterzeichneten Resolution heißt es: „Die Unterzeichnenden wollen den Gesetzgeber auf die unbeabsichtigten schädlichen Nebenwirkungen und Folgen der Kriminalisierung bestimmter Drogen aufmerksam machen. Sie wollen das Parlament anregen, bezüglich dieser Thematik seinem verfassungsrechtlichen Auftrag im Allgemeinen und den wissenschaftlich begründeten Prinzipien von Strafgesetzgebung und Kriminalpolitik im Besonderen durch die Einrichtung einer Enquête-Kommission Rechnung zu tragen.“
Im Juni 2014 wurde der Antrag „Beabsichtigte und unbeabsichtigte Auswirkungen des Betäubungsmittelrechts überprüfen“ durch die Fraktionen der Linken und der Grünen im Deutschen Bundestag eingebracht. Er greift die Resolution an den Bundestag auf, die von der Hälfte aller deutschen Strafrechtsprofessorinnen und -professoren getragen wird. Sie stellen die Eignung der Drogenprohibition und damit die Verfassungsmäßigkeit der heutigen Drogenpolitik in frage. Deswegen wird eine Überprüfung der Wirksamkeit und der Auswirkungen des Betäubungsmittelrechts eingefordert. Nach der Debatte im Bundestag fand am 5. November 2014 eine öffentliche Sitzung des Bundestagsausschusses für Gesundheit zum besagten Antrag statt. Die meisten der geladenen Experten unterstützten den Antrag. Doch CDU, CSU und SPD zeigen nicht das geringste Interesse an der Einsetzung einer Enquête-Kommission zur Evaluierung ihrer Drogenpolitik.
Vergl. hierzu in diesem Blog den Artikel vom 15.04.2014
Menschenrechte, Drogen und die UNO
und den Artikel vom 15.02.2014
UNODC finanziert Irans blutigen War on Drugs