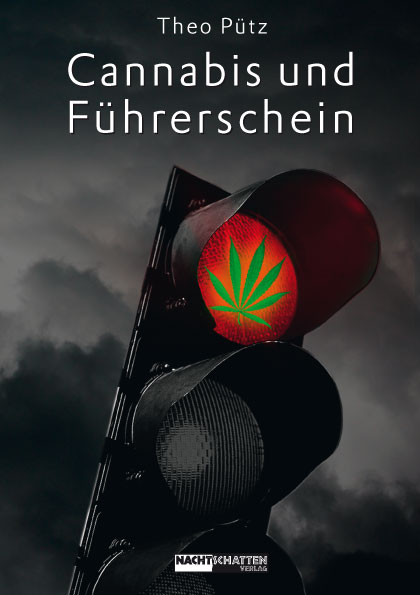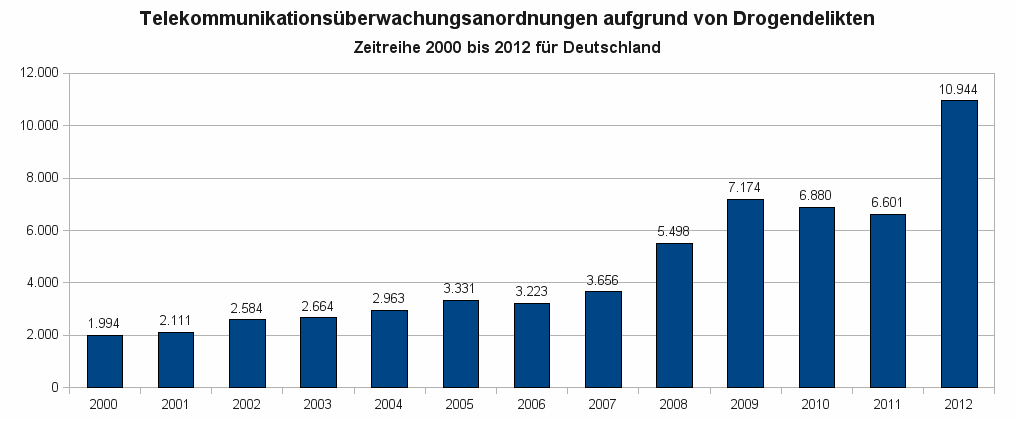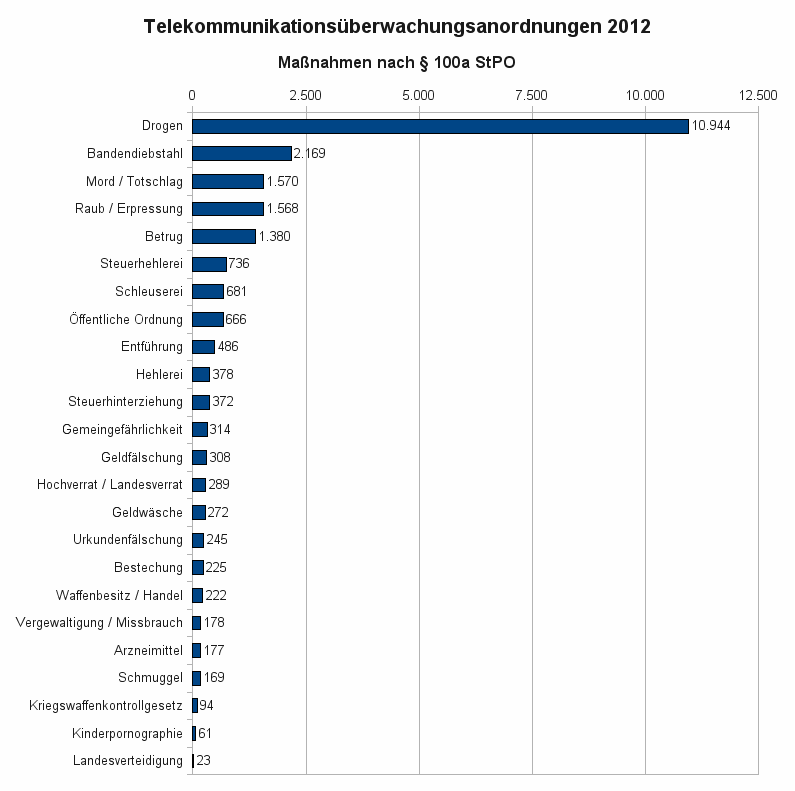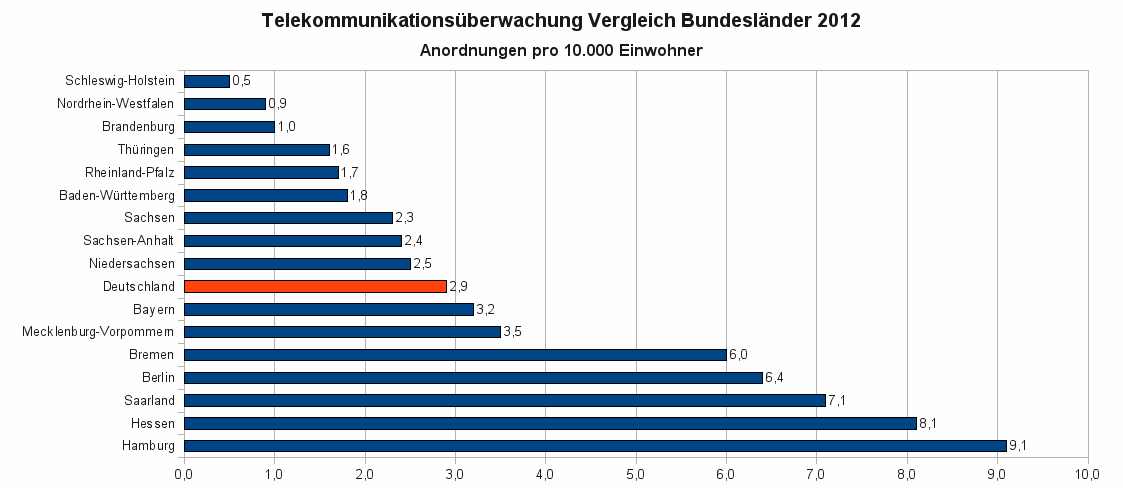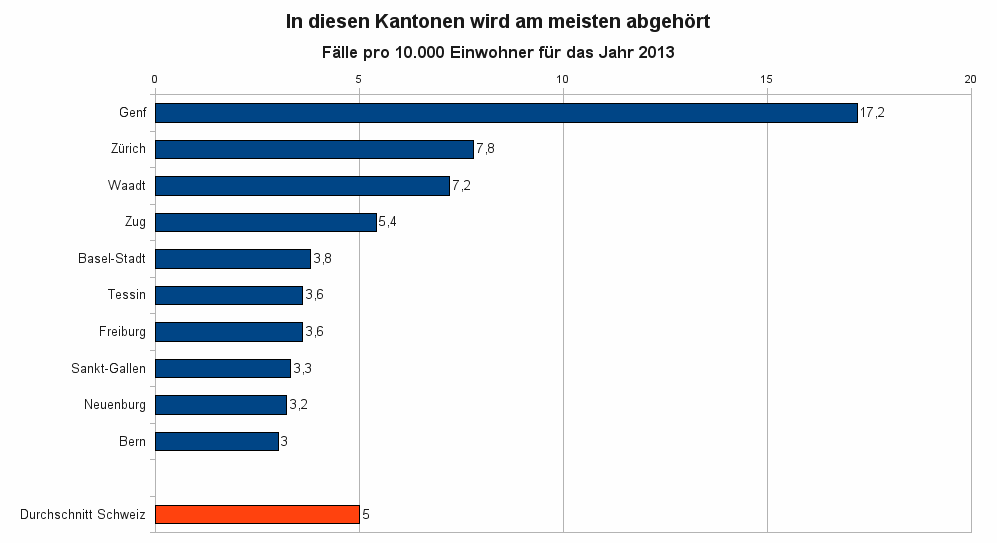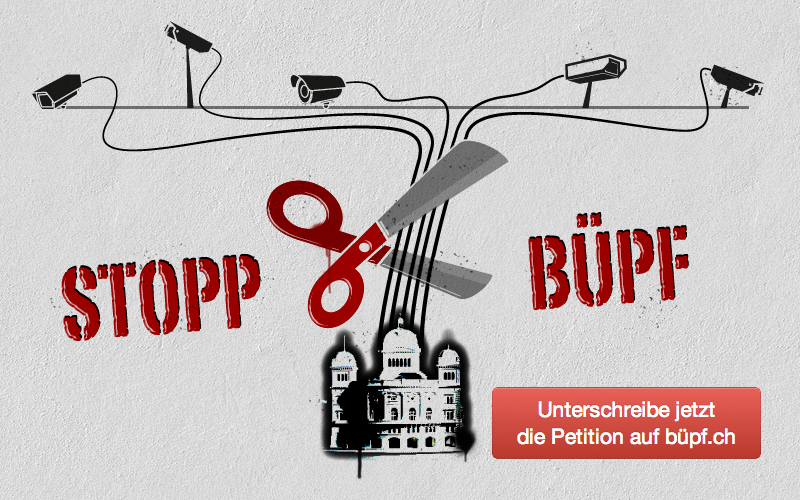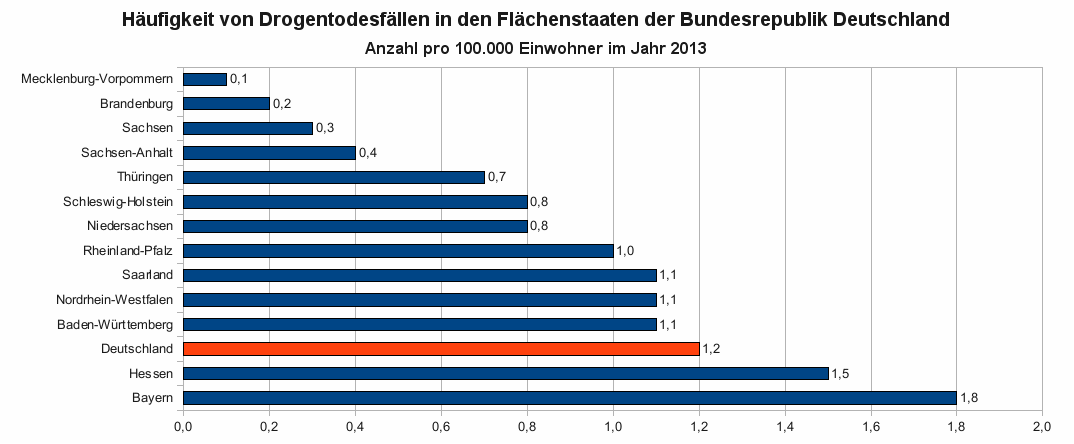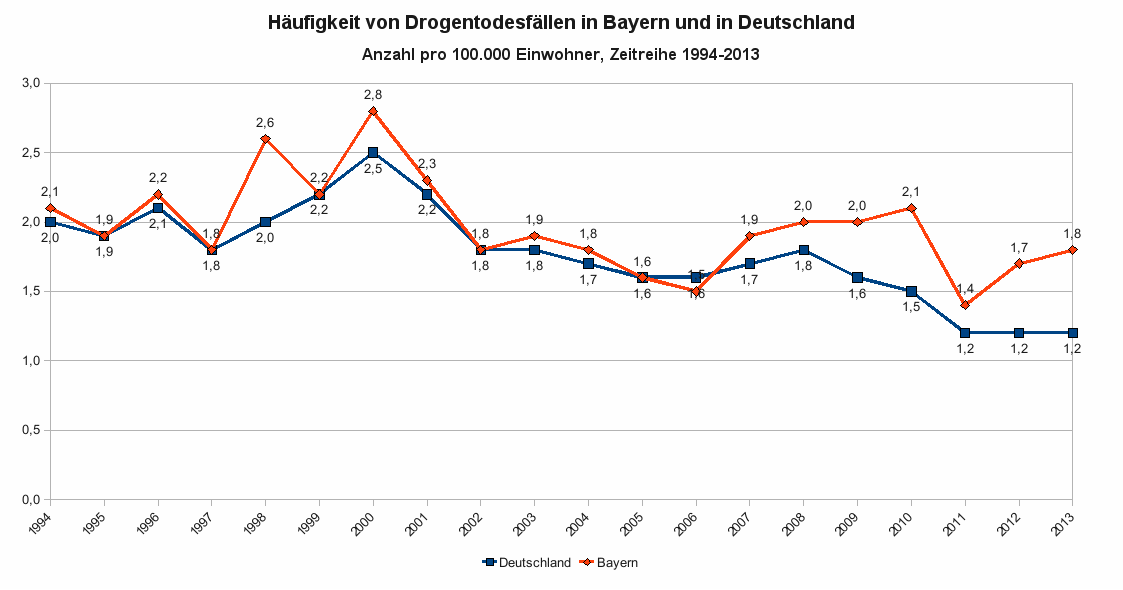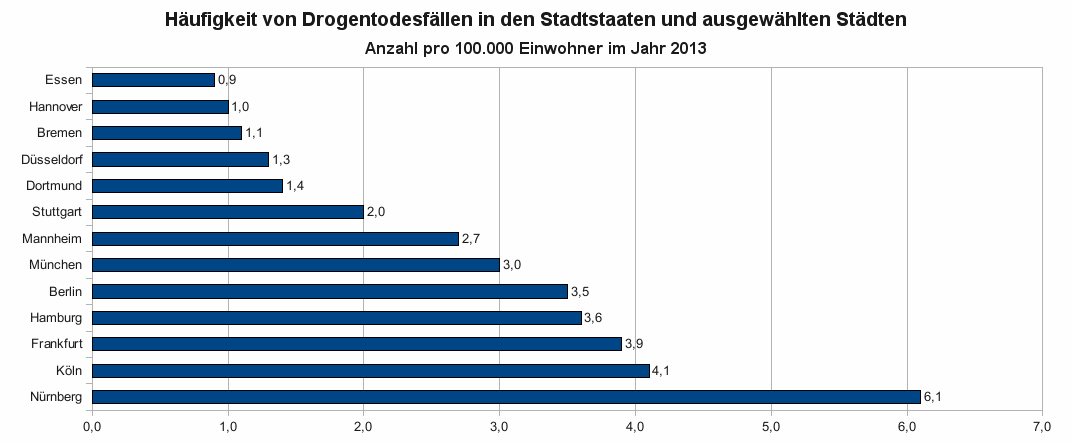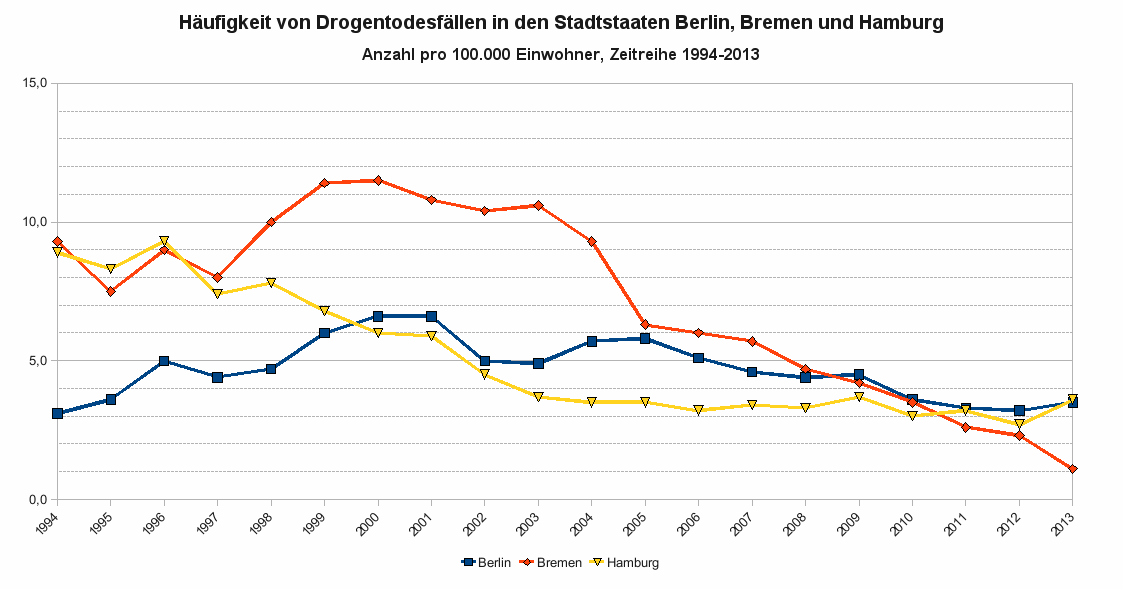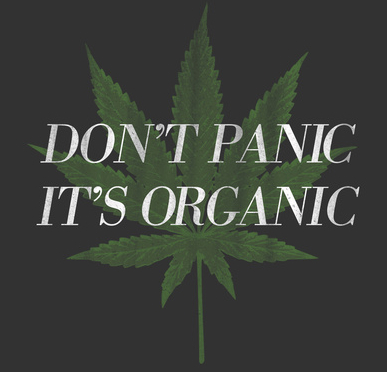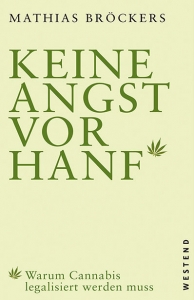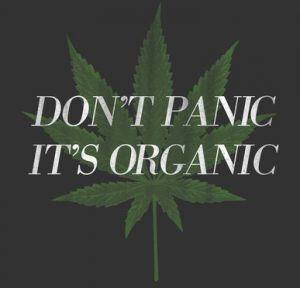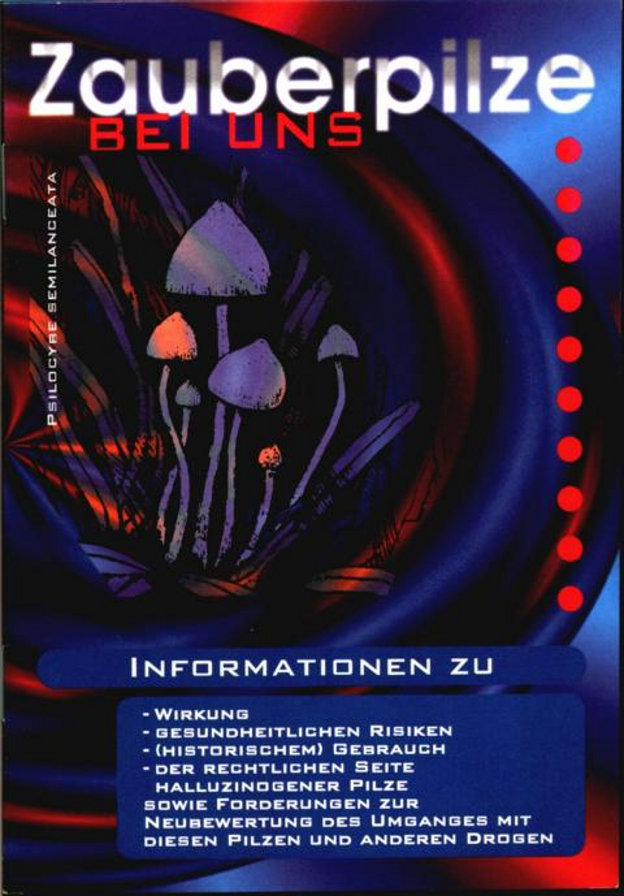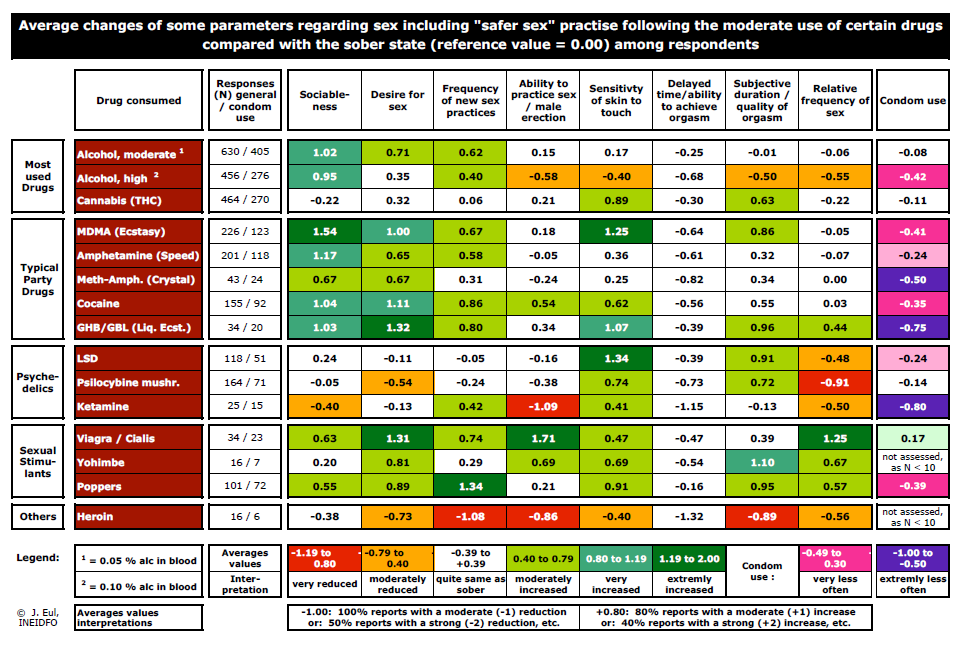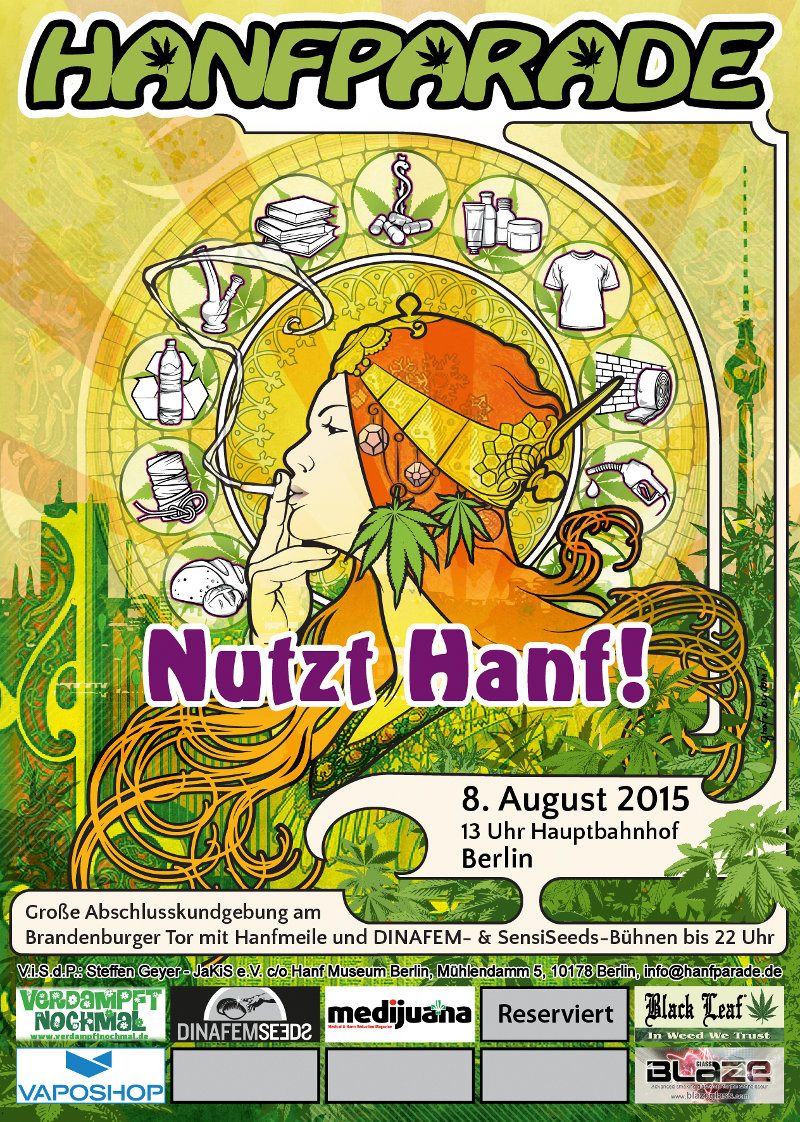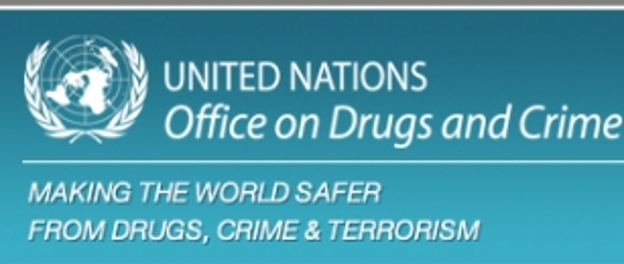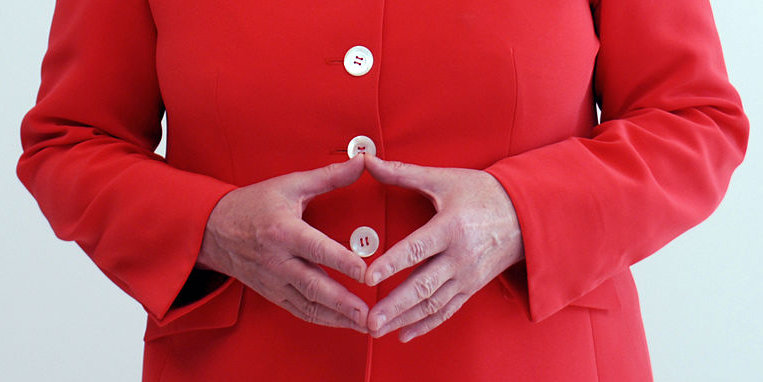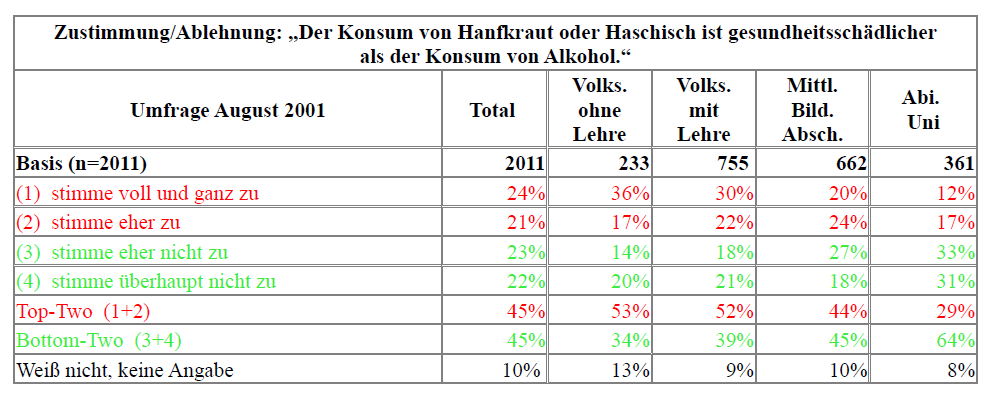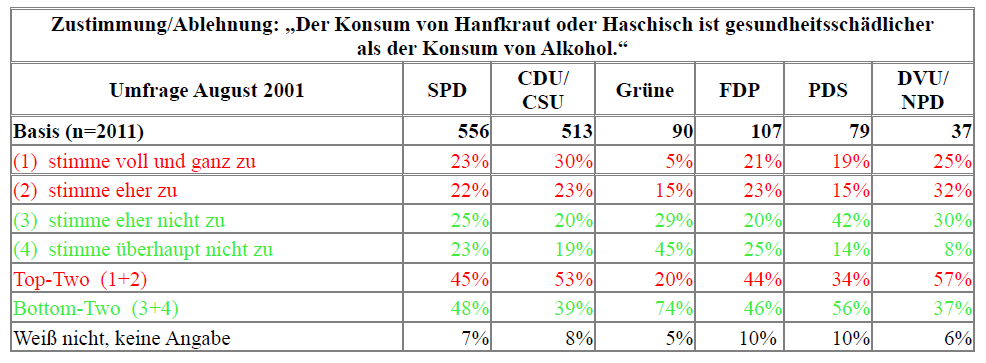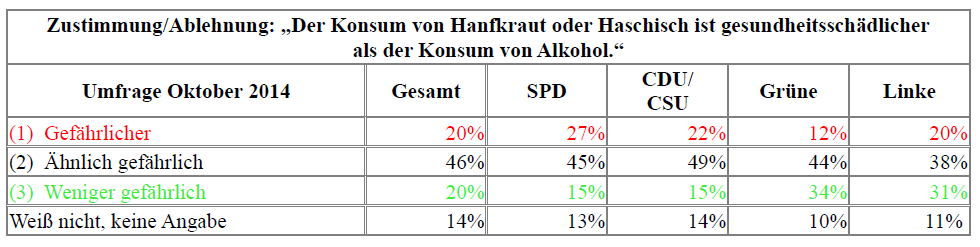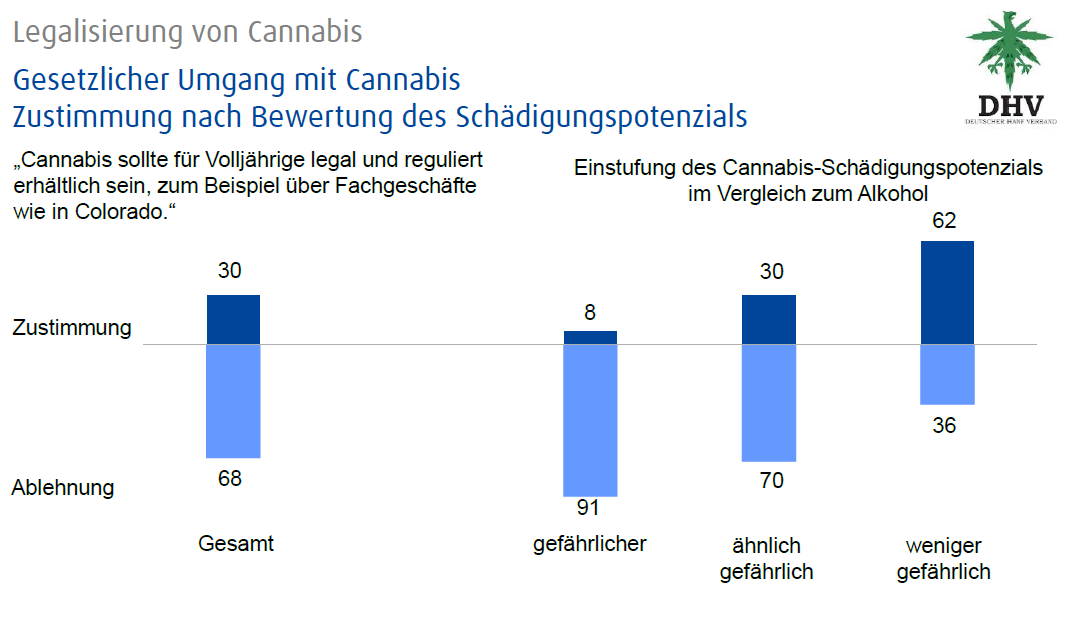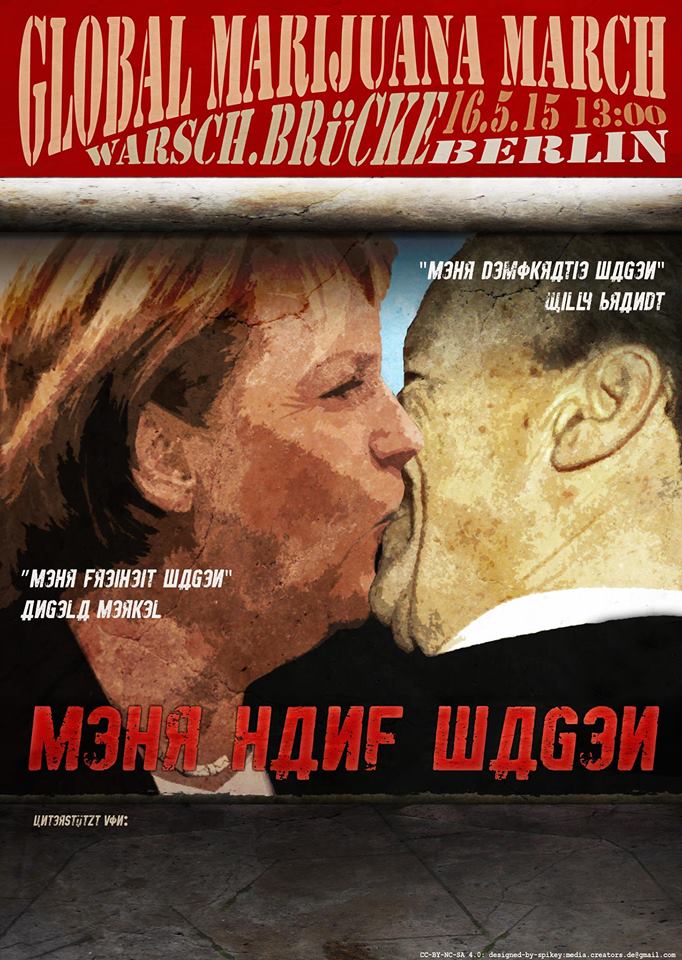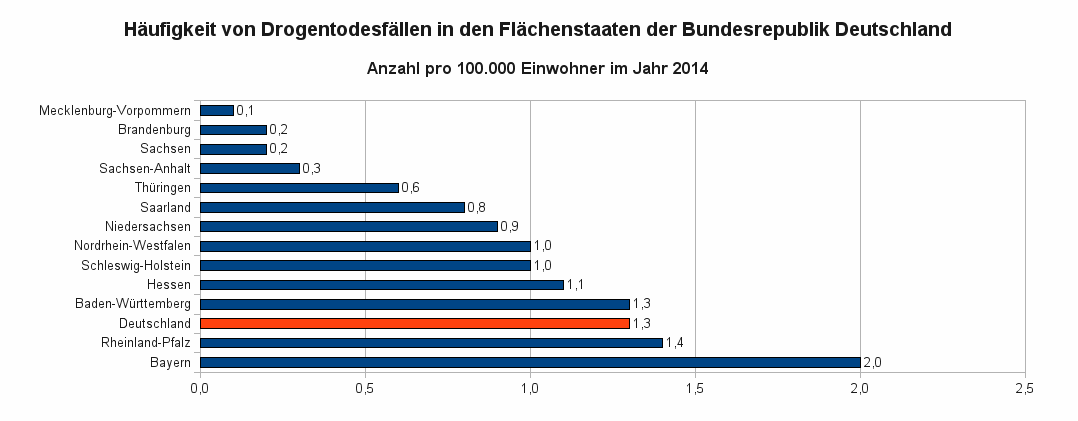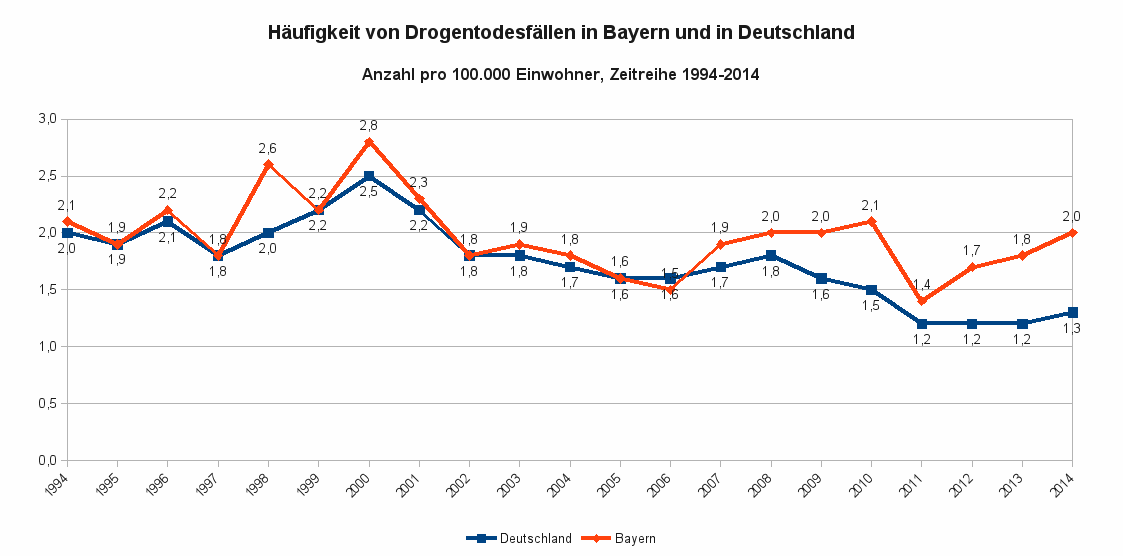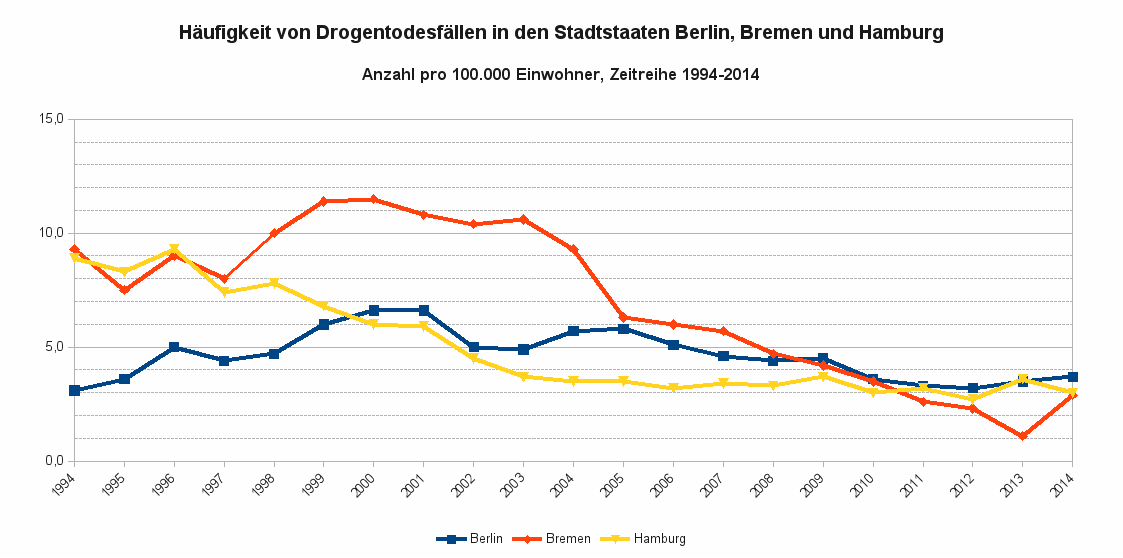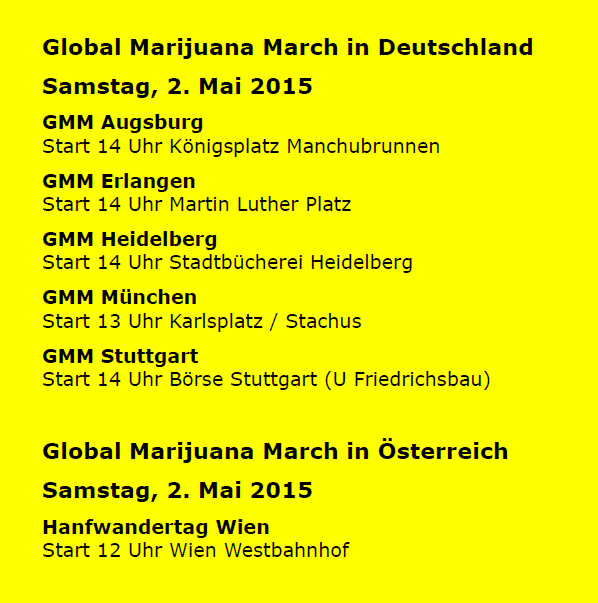Rechtzeitig zum 52. Deutsche Verkehrsgerichtstag (52. VGT) vom 29. bis 31. Januar 2014 in Goslar veröffentlichte der Nachtschatten Verlag in Solothurn das umfassende Nachschlagewerk „Cannabis und Führerschein“ von Theo Pütz vom Verein für Drogenpolitik. Theo Pütz ist nicht nur einer der bekanntesten Experten in Sachen Verkehrsrecht, sondern gilt auch als bester Kenner der Materie betreffend medizinisch-psychologische Untersuchungen (MPU). Die MPU erstreckt sich auf drei Bereiche – eine ärztliche und eine psychologische Untersuchung und einen Leistungstest.
Seit Mitte der neunziger Jahre müssen immer mehr Cannabiskonsumenten zur Fahreignungsüberprüfung, da die Fahrerlaubnisbehörden davon ausgehen, dass bei einem Cannabiskonsumenten die Gefahr besteht, dass er unter Rauschwirkung am Kraftverkehr teilnimmt. Oft wird der Führerschein durch die Fahrerlaubnisbehörde entzogen, wenn bei einer Verkehrsteilnahme der Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC) im Blutserum nachgewiesen wird. Aber nicht nur in Bezug auf eine vermeintliche „Drogenfahrt“ laufen Cannabiskonsumenten Gefahr, ihre Fahrerlaubnis zu verlieren. Auch bei Besitzdelikten, selbst wenn es nur geringe Mengen Cannabis waren und das Strafermittlungsverfahren eingestellt wurde, muss grundsätzlich damit gerechnet werden, dass der Betroffene noch Post von seiner Führerscheinstelle erhält. Dies gilt auch, wenn das „Delikt“ in keinem Zusammenhang mit der Teilnahme am Straßenverkehr steht.
Mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 1994 wurde der Besitz geringer Mengen Cannabis für den Eigenbedarf ein Stück weit entkriminalisiert. Damit wurde dem Umstand Rechnung getragen, dass aufgrund der vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse das Gefahrenpotenzial von Cannabis mit dem von Alkohol vergleichbar ist und in der Regel nicht über die Gefahren hinausgeht, die durch Alkohol zu erwarten sind. Genau diese vom Bundesverfassungsgericht angestoßene Entkriminalisierung des Cannabiskonsums führte aber auch dazu, dass sich der Verfolgungsdruck auf die Cannabiskonsumenten inzwischen in den Bereich der Verkehrssicherheit verschoben hat. Diese stehen oft da wie der Ochs am Berg, weil sie nicht nach vollziehen können, wieso von ihnen eine besondere Gefahr für die Verkehrssicherheit ausgehen soll, wenn sie im Straßenverkehr doch gar nicht aufgefallen und auch nicht unter der Wirkung von Cannabis gefahren sind. Hinzu kommt, dass die rechtlichen Möglichkeiten für die Betroffenen, sich gegen solche Vorwürfe zu wehren, im Bereich des Verwaltungsrechts äußerst begrenzt sind. So fühlen sie sich insbesondere den Verwaltungsbehörden und später der vermeintlichen Willkür der Begutachtungsstellen ausgesetzt.
Dabei haben sie sich häufig überhaupt nichts zuschulden kommen lassen, wenn man einmal davon absieht, dass der Besitz von Cannabis nach wie vor unter das Betäubungsmittelgesetz fällt und sie damit eine Straftat begehen, die allerdings eher im Bagatellbereich anzusiedeln ist. Deshalb scheitern Cannabiskonsumenten auch oft an der psychologischen Begutachtung bei der medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU). Denn wie sollen sie sich kritisch mit einer vermeintlichen Drogenfahrt auseinandersetzen, die gar nicht stattgefunden hat oder bei der nach ihrem subjektiven Empfinden keine Rauschwirkung mehr vorlag?
Diese Problematik ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass der Gesetzgeber davon ausging, dass die Wirkung des berauschenden Cannabiswirkstoffs Tetrahydrocannabinol (THC) so lange anhält, wie er im Blut nachweisbar ist, und daher einen Null-Promille-Grenzwert eingeführt hat. Dieser wurde zwar zwischenzeitlich vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig verworfen; der Gesetzgeber hat es aber bisher nicht für nötig befunden, einen THC-Grenzwert zu normieren, und überlässt die THC-Grenzwertfindung der Rechtsprechung.
Dass die erwähnten verfassungsrechtlichen Grundsätze in der Rechtspraxis bei Cannabiskonsumenten eingehalten werden, bezweifeln nicht nur unmittelbar Betroffene. Obwohl die Bundesregierung nachweislich beteuert, dass die Änderungen im Verkehrsrecht nicht dazu dienen sollen, den Konsum bzw. den Umgang mit Cannabis als solchen zu bestrafen, wird die Rechtspraxis durch die Betroffenen als Ersatzstrafrecht empfunden.
Betrachtet man die Rechtsentwicklung seit den neunziger Jahren etwas genauer, liegt der Verdacht nahe, dass der Gesetzgeber hier primär die Einschränkungen zu kompensieren sucht, die durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auf Strafrechtsebene entstanden sind (Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, BtMG). Auch heute, bald zwanzig Jahre nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, werden Fahreignungsüberprüfungen nach wie vor alleine aufgrund von Besitztatbeständen angeordnet, obwohl dies eindeutig verfassungswidrig ist.
Grenzwerte
In einer Metaanalyse bestehender Forschungsergebnisse aus dem Jahr 1997 heißt es:
„Als besonders empfindlich gegenüber einer THC-Wirkung erweisen sich Aufmerksamkeit, Tracking und Psychomotorik. Fahren als Ausdruck von Mehrfachleistung erscheint dagegen als relativ unempfindlich. Im THC-Konzentrationsbereich 7–15 ng/ml (Nanogramm pro Milliliter) sind nach vorliegenden Ergebnissen für das Verkehrsverhalten wesentliche Leistungeinschränkungen zu erwarten.“
Anmerkung: Die der Auswertung der Studie zugrundeliegenden Messergebnisse (THC im Blut) wurden wie international üblich im Gesamtblut bestimmt. In der Bundesrepublik wird der Wert im Blutserum bestimmt und führt somit zu einem mehr als doppelt so hohen Wert. Quelle: Metaanalyse bestehender Forschungsergebnisse von Schulz/Vollrath im Auftrag der BASt: „Fahruntüchtigkeit durch Cannabis, Amphetamine und Cocain“. Mensch und Sicherheit, Heft M82.
In der Studie des Zentrums für Verkehrswissenschaften Würzburg von 2005 heißt es:
„Nach Abklingen der Wirkung und der damit verbundenen eingeschränkten Fahrtauglichkeit sind im Blut noch bis zu 48 Stunden nach dem Konsum geringe THC-Konzentrationen nachweisbar, wodurch beeinträchtigte und unbeeinträchtigte Fahrer verkehrsstrafrechtlich nicht getrennt werden. Analog zur 0,5 Promille-Grenze bei Alkohol könnte bei THC ein Wert zwischen 7 und 8 ng pro ml THC im Blutserum eingeführt werden. Ein mit 0,3 Promille Alkohol vergleichbarer Grenzwert für eine beeinträchtigte Fahrleistung könnte bei Cannabiskonsumenten bei 3 ng THC/ml Blutserum liegen.“
Quelle: Dokumentation der 12. Tagung des Netzwerkes Sucht in Bayern: Drogen und Fahrerlaubnis – Rotlicht für Cannabis im Straßenverkehr, 21. September 2005 in Nürnberg
Straßenverkehrsgesetz und Grenzwerte
Im Zuge der Erneuerung des § 24a Straßenverkehrsgesetz (StVG) und der zugehörigen Anlage wurde ein 0,0-Promille-Wert für illegale Substanzen eingeführt, in der Annahme, dass der Wirkstoff THC im Blut nur sehr zeitnah zum Konsum nachweisbar sei. Zudem ging der Gesetzgeber auch davon aus, dass dieser Nullwert dazu führen würde, dass sich die Betroffenen besser daran halten können, da keine Möglichkeit besteht, dass sich die Konsumenten wie beim Alkohol an den Grenzwert sozusagen herankiffen können.
Im Dezember 2004 musste sich das Bundesverfassungsgericht mit der Frage beschäftigen, ob die vom Gesetzgeber vorgegebene 0,0-Promillegrenze für Cannabis verfassungskonform ist. Ausgangspunkt war ein Fall, bei dem bei einem Fahrzeugführer ein THC-Wert von 0,5 ng/ml im Blutserum festgestellt wurde. Die Verfassungsrichter stellen fest, dass der Nullwert verfassungswidrig erscheint, da der Normtext des § 24a StVG eine Fahrt unter der Wirkung verbietet, aber nicht jeder Nachweis auch mit einer Wirkung gleichzusetzen ist. Im weiteren verweisen die Richter zwar auch auf den von der Grenzwertkommission vorgeschlagenen Grenzwert von 1 ng/ml, stellen aber vielmehr darauf ab, dass ein zeitlicher Kontext zwischen Konsum und Verkehrsteilnahme vorgelegen haben muss, um auch von einer Wirkung ausgehen zu können.
Die zuständigen Strafgerichte, die über die Fälle zu entscheiden haben, orientieren sich seit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts an dem von der Grenzwertkommission vorgeschlagenem Grenzwert von 1 ng/ml. Trotz der Erkenntnis, dass es sich hierbei lediglich um den analytischen Grenzwert handelt, der keine Wirkschwelle beschreibt und THC-Werte über 1 ng/ml unter Umständen selbst Tage nach dem letzten Konsum nachweisbar sind, halten die Gerichte an diesem Wert fest.
DRUID-Studie
Mit der Studie „Driving Under Influence of Drugs, Alcohol and Medicines“ (DRUID) der Europäischen Union wurden erstmalig epidemiologische und experimentelle Untersuchungen des Einflusses von Drogen und Arzneimitteln auf die Fahrtüchtigkeit beziehungsweise auf verkehrssicheres Verhalten, die im Rahmen der polizeilichen Überwachung zum Drogennachweise durchgeführt wurden, zusammengetragen.
Im Abschlussbericht „Durchgeführte Arbeiten, wichtigste Ergebnisse und Empfehlungen“ der europäischen DRUID-Studie wurden allerdings nur solche Fälle als Drogenfahrten gewertet, bei denen der THC-Wert über 1 ng/ml im Vollblut lag – Fälle, bei denen z.B. nur ein THC-Nachweis von 0,5 ng/ml im Gesamtblut ermittelt wurde, wurden also nicht als Drogenfahrt erfasst. In Deutschland, wo im Blutserum gemessen wird, entsprechen 0,5 ng/ml im Blut aber einem Wert von 1 ng/ml und führen zu einer Verurteilung wegen einer vermeintlichen Drogenfahrt.
Ausland
In der Schweiz wurde vor einigen Jahren ein THC-Grenzwert für das Fahrpersonal (Bus, Bahn) eingeführt. Dieser Grenzwert, der im übrigen mit der 0,0-Promille-Grenze für Taxifahrer vergleichbar ist, liegt in der Schweiz bei 1,5 ng/ml THC; der in Deutschland geltende Grenzwert von 1 ng/ml scheint auf den ersten Blick nur unwesentlich tiefer zu sein. Berücksichtigt man nun allerdings den Umstand, dass der Schweizer Grenzwert im Gesamtblut und nicht im Serum bestimmt wird, ergibt sich rechnerisch ein Grenzwert von 3 ng/ml Serum bzw. der Grenzwert für das Fahrpersonal in der Schweiz liegt nach deutscher Lesart bei 3 ng/ml Serum. Ja, in der Schweiz geht man davon aus, dass selbst Fahrer von Bussen und Bahnen mit bis zu 3 ng/ml THC im Blutserum ihrer Arbeit verantwortungsvoll nachgehen können. In Deutschland wird aber schon bei einem THC-Nachweis von 1 ng/ml Serum von einer „Rauschfahrt“ ausgegangen.
Wenn man nun bedenkt, dass der deutsche Gesetz- bzw. Verordnungsgeber allem Anschein nach davon überzeugt ist, dass ab einem THC-Wert von über 1 ng/ml von einer Drogenbeeinflussung ausgegangen werden muss, stellt sich die Frage, wieso die Bundesregierung nicht davor warnt, in der Schweiz öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, wenn die Fahrer von Bussen und Bahnen dort sogar unter der Wirkung von THC (bis zu 3 ng/ml) ihren verantwortungsvollen Beruf ausüben dürfen.
Im US-Bundesstaat Colorado wurde im Mai 2013 der Umgang mit Cannabis legalisiert. Gleichzeitig hat Colorado auch einen Grenzwert für die Verkehrsteilnahme eingeführt. Dieser Grenzwert liegt bei 5 ng/ml, gemessen im Vollblut. Würde man hier ebenfalls dem Umrechnungsfaktor (Vollblut/Serum) berücksichtigen, käme man auf einen analogen Grenzwert von 10 ng/ml Serum. In den USA, dem Mutterland der Cannabis-Prohibition und des irrsinnigen „War On Drugs“, gilt selbst ein Grenzwert (10 ng/ml), der zehn Mal höher liegt als in Deutschland (1 ng/ml), nicht als Gefahr für die Verkehrssicherheit. Die (Un-)Rechtspraxis in Deutschland, mit Hilfe des Fahrerlaubnis- und Verwaltungsrechts den „Krieg gegen Drogen“ zu führen, muss beendet werden. Die Politik und die Rechtssprechung sind gefordert. Wer die Informationen in dem Buch „Cannabis und Führerschein“ von Theo Pütz zur Kenntnis genommen hat, wird nicht mehr umhin können, diese Forderung zu unterstützen.
![Theo Pütz: Cannabis und Führerschein]()
Anmerkung:
Weitgehende Passagen dieses Artikels sind direkt dem Buch „Cannabis und Führerschein“ von Theo Pütz entnommen. Mathias Broeckers schrieb das Vorwort, aus dem die ersten Absätze dieses Artikel entnommen wurden. Das Buch ist ein Muss für alle Rechtsanwälte, Richter und Politiker, die sich mit Fragen zu Cannabis und Führerschein respektive Fahrerlaubnis konfrontiert sehen.
Theo Pütz: Cannabis und Führerschein
176 Seiten, Format A5, Broschur
ISBN: 978-3-03788-279-5
CHF 29.80, EUR 23.00
Vergl. hierzu:
Polizeikontrolle und Drogenschnelltests: Im Tagesrausch „Polizeikontrolle und Schnelltests“ informiert Theo Pütz über das richtige Verhalten bei Drogenkontrollen im Straßenverkehr. Was muss man über Wisch-, Piss- und Schweißtests wissen? Welche Regeln gelten für die Blutentnahme? Was sollte man sagen, was lieber verschweigen. Im Teil zwei des Interviews über Drogen im Straßenverkehr „Blutprobe und Trunkenheitsfahrt“ informiert Theo Pütz über die Nachweiszeiten verschiedener Drogen und erklärte die Folgen positiver Blutproben. Im dritten Teil der Interviewserie „MPU und Führerscheinentzug“ erklärt er unter anderem, warum selbst diejenigen Konsumenten, die nie berauscht gefahren sind, eine MPU (Idiotentest) fürchten müssen und unter welchen Umständen der Führerschein entzogen wird.
![flattr this!]()
 Georg Wurth und der Deutsche Hanfverband (DHV) gewannen am Samstagabend die “erste demokratische Millionärswahl”. Für den TV-Sender Pro7 war die “Millionärswahl” ein Quoten-Flop, dessen Finale dann sogar aus dem TV ins Internet verbannt wurde. Für den Deutschen Hanfverband (DHV) dagegen war die erste “demokratische Millionärswahl” ein Segen, den zu Beginn niemand erwartet hatte: eine Million Euro für die Kampagne um die Entkriminalisierung von Cannabis.
Georg Wurth und der Deutsche Hanfverband (DHV) gewannen am Samstagabend die “erste demokratische Millionärswahl”. Für den TV-Sender Pro7 war die “Millionärswahl” ein Quoten-Flop, dessen Finale dann sogar aus dem TV ins Internet verbannt wurde. Für den Deutschen Hanfverband (DHV) dagegen war die erste “demokratische Millionärswahl” ein Segen, den zu Beginn niemand erwartet hatte: eine Million Euro für die Kampagne um die Entkriminalisierung von Cannabis.