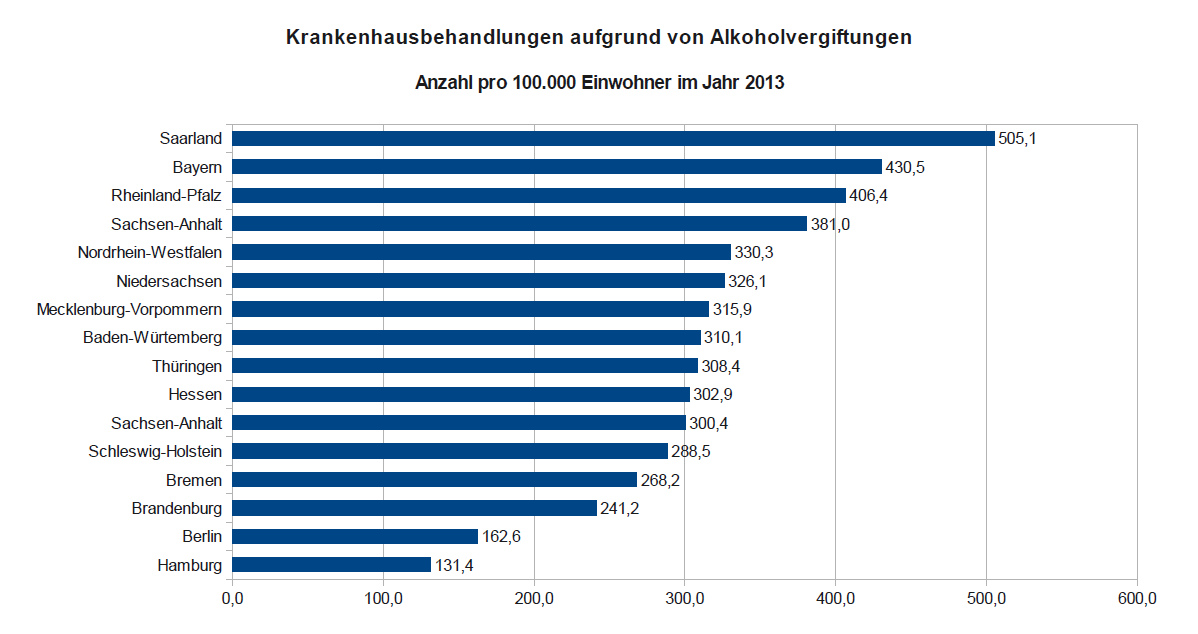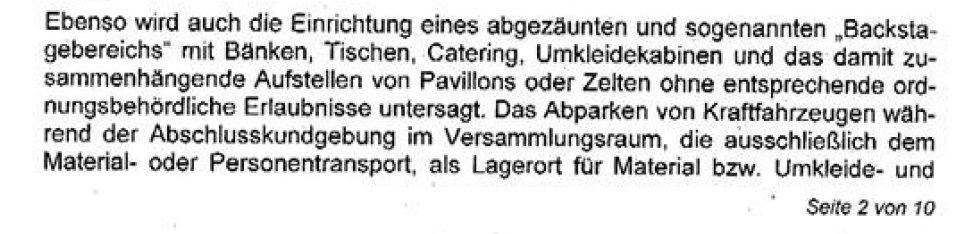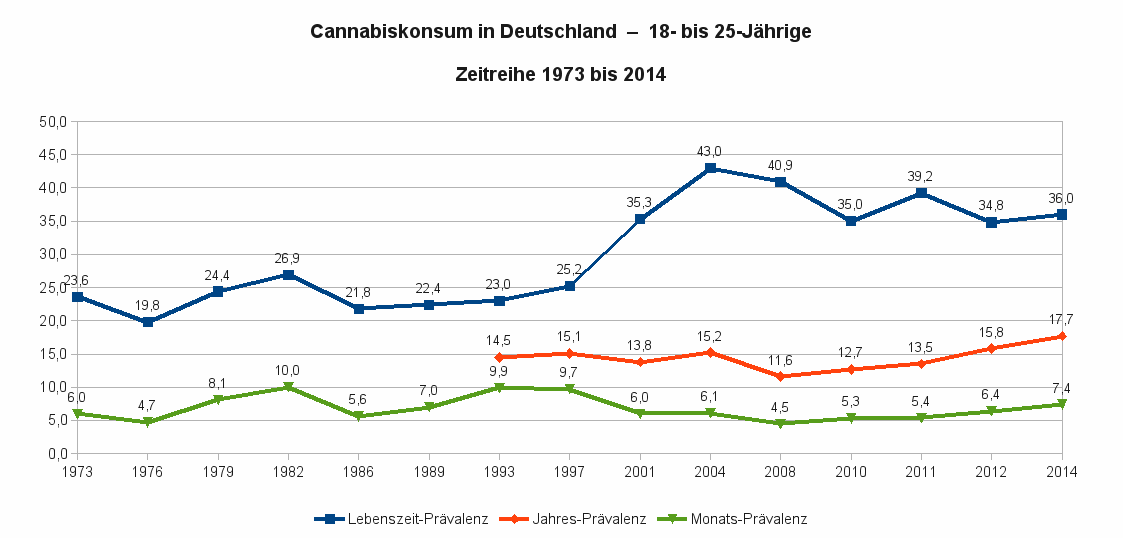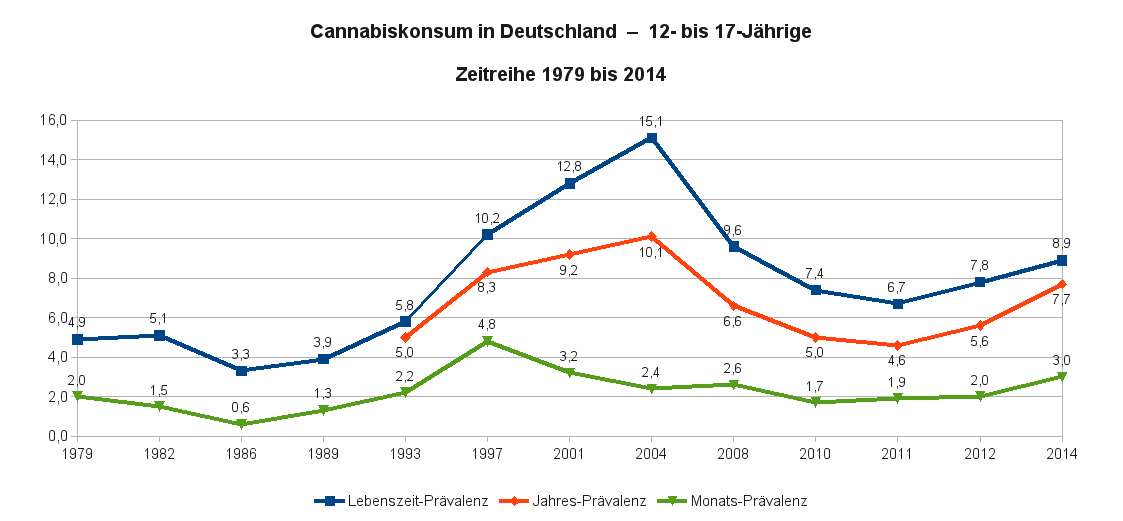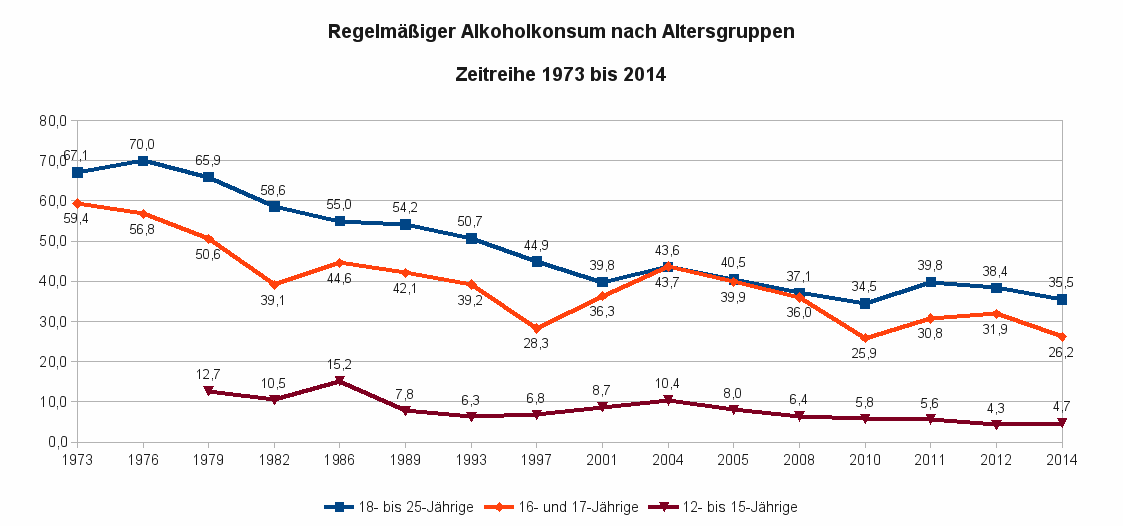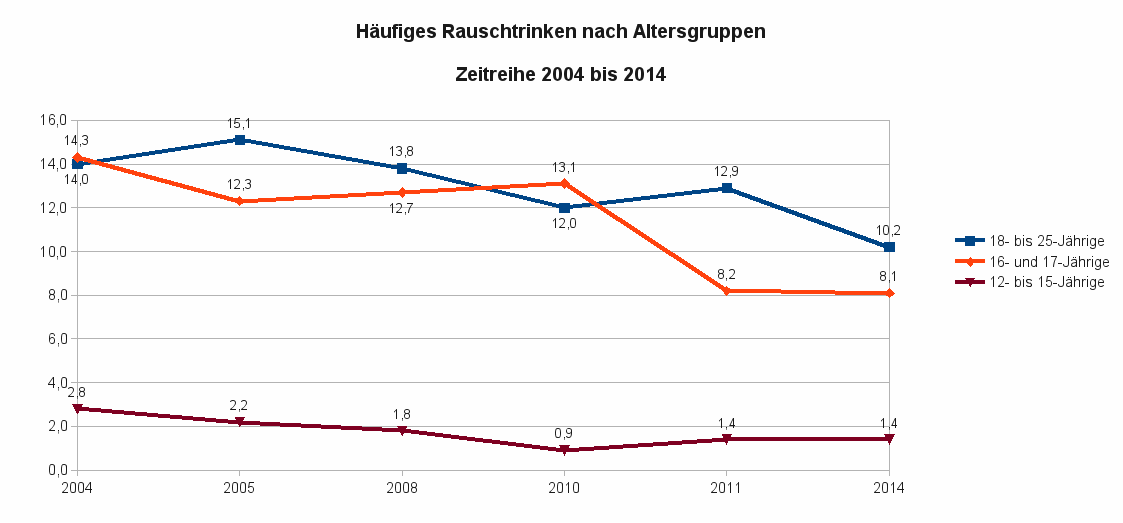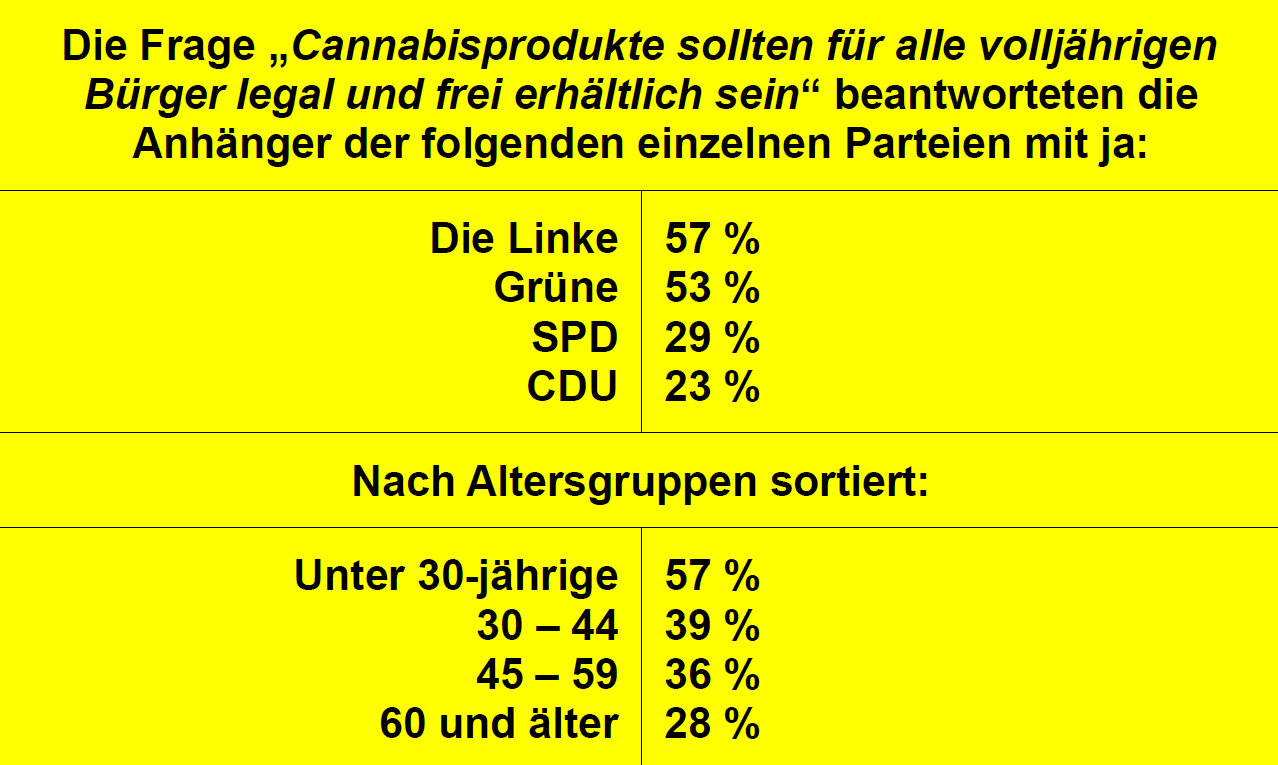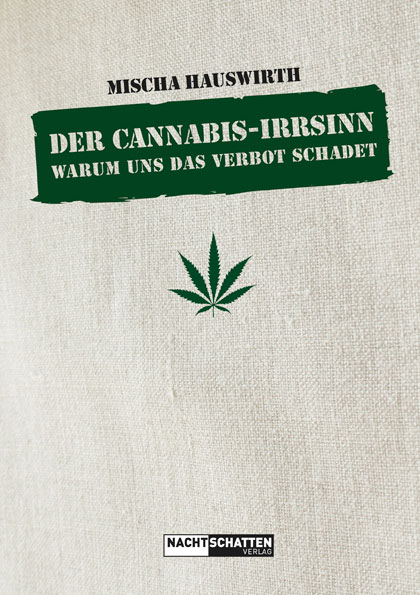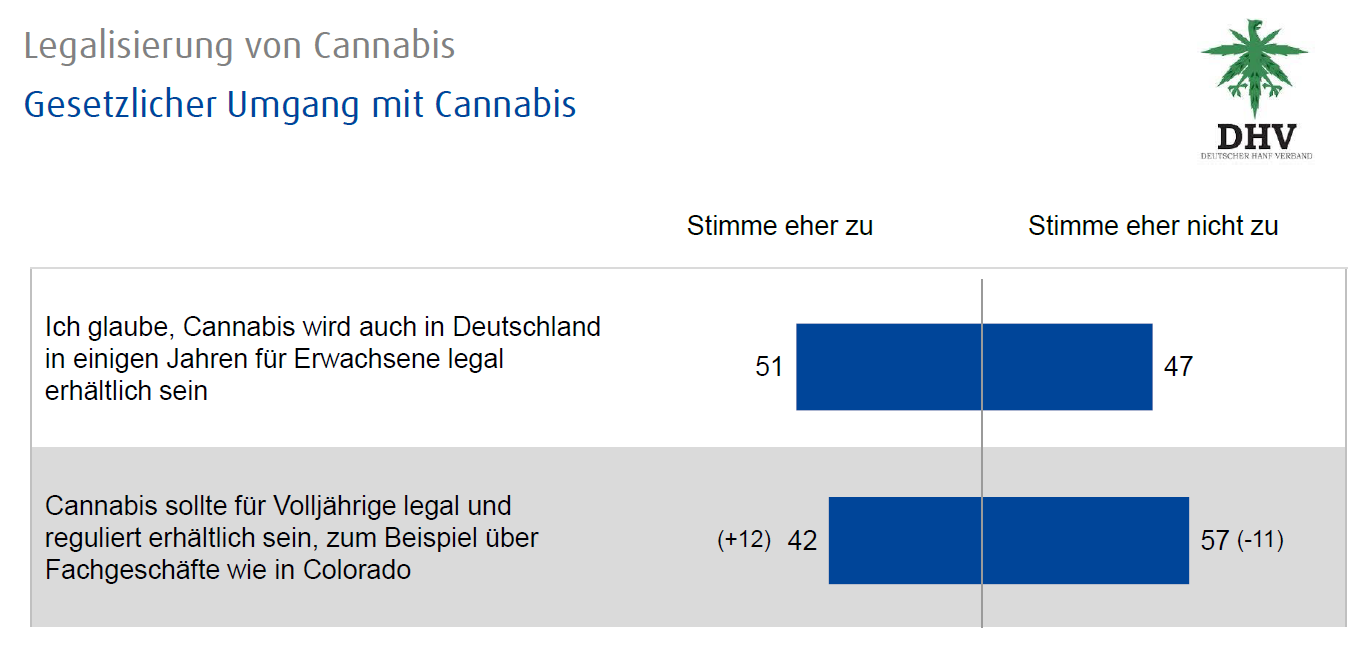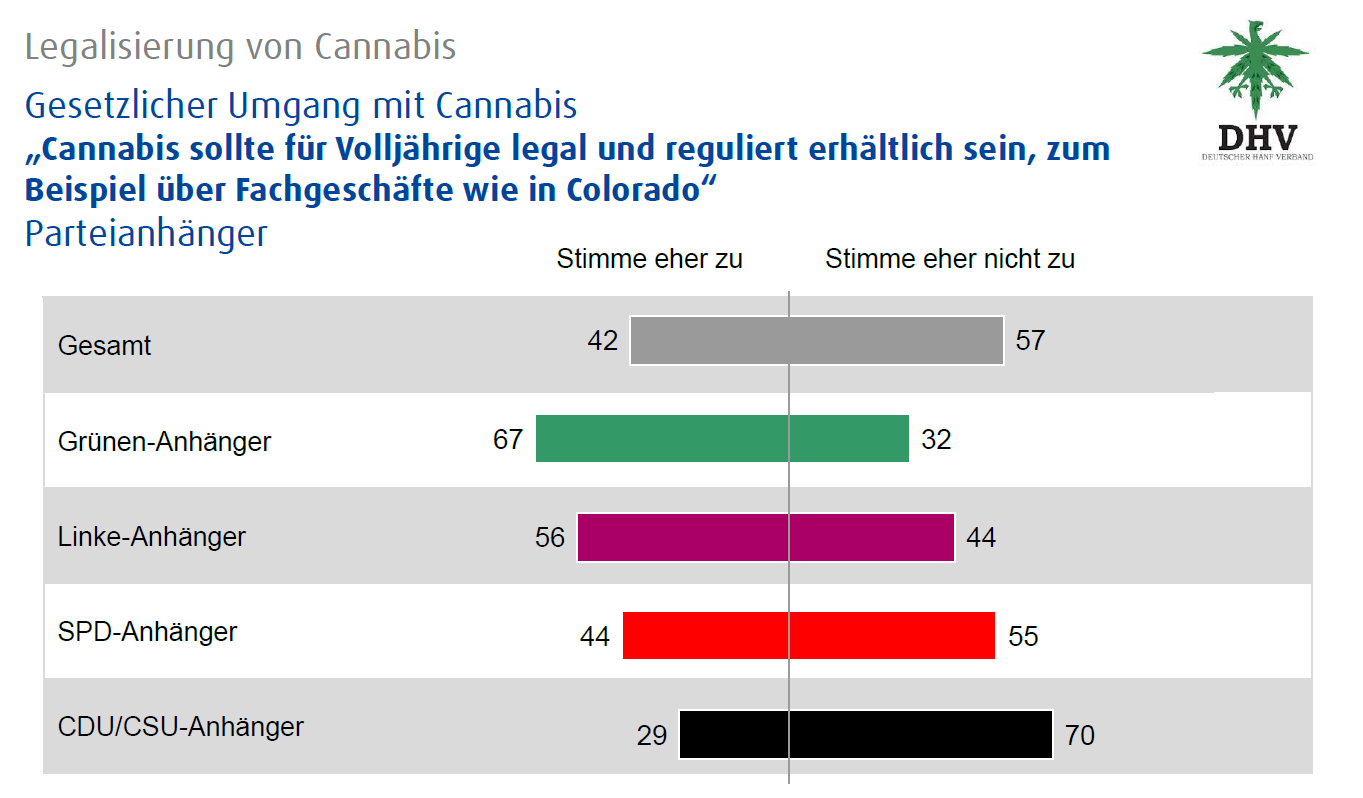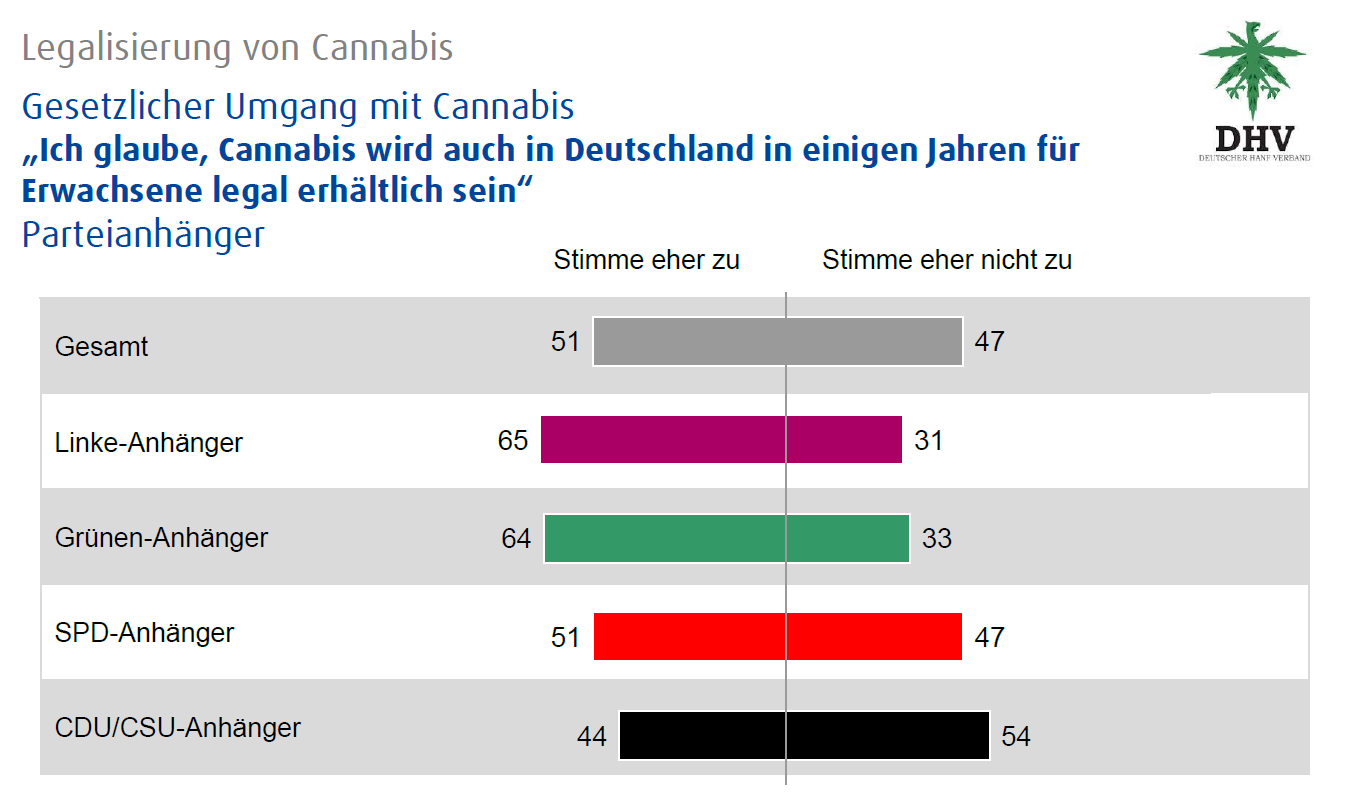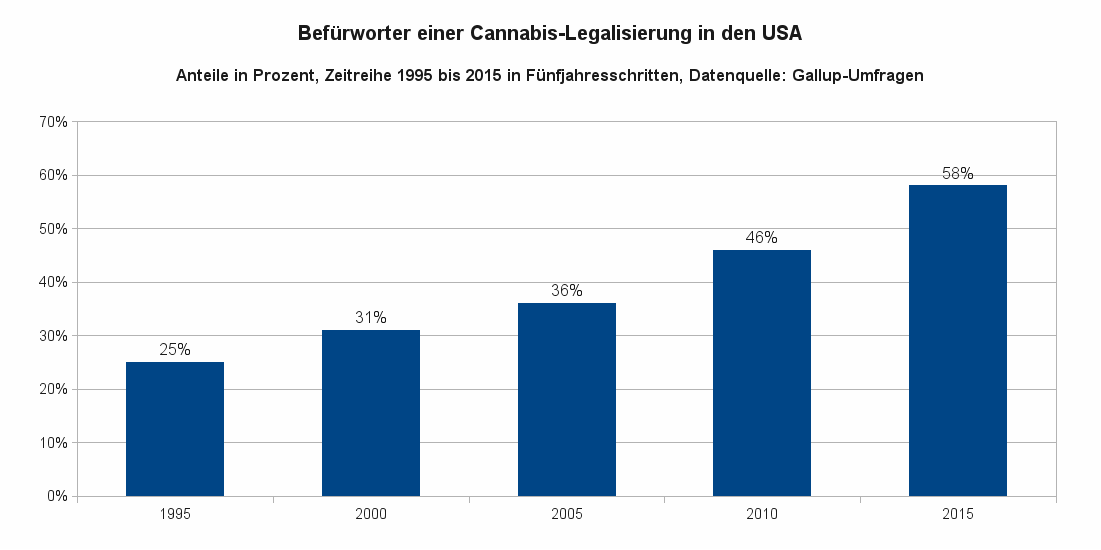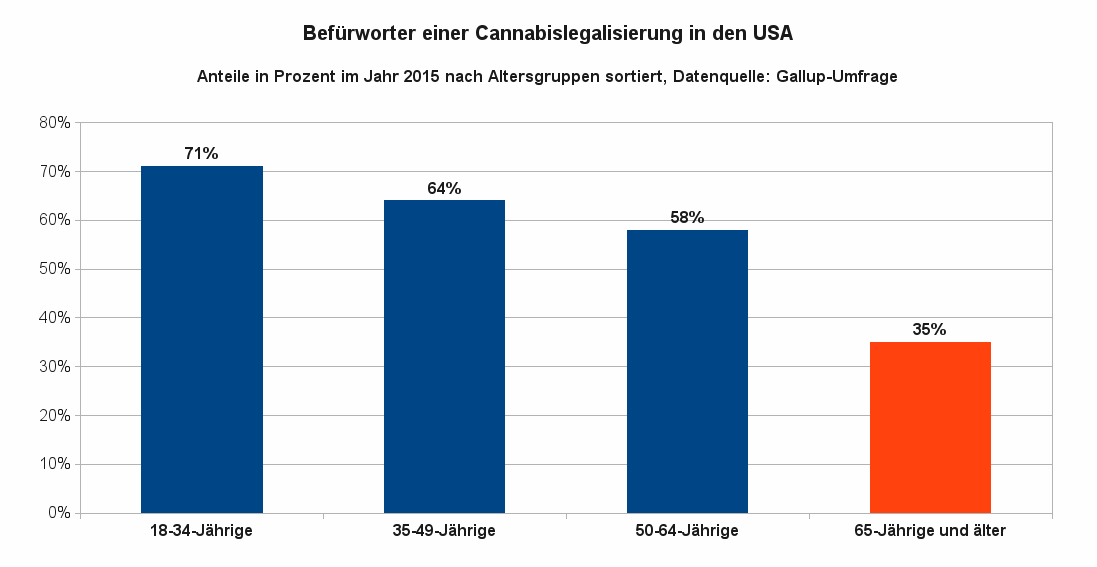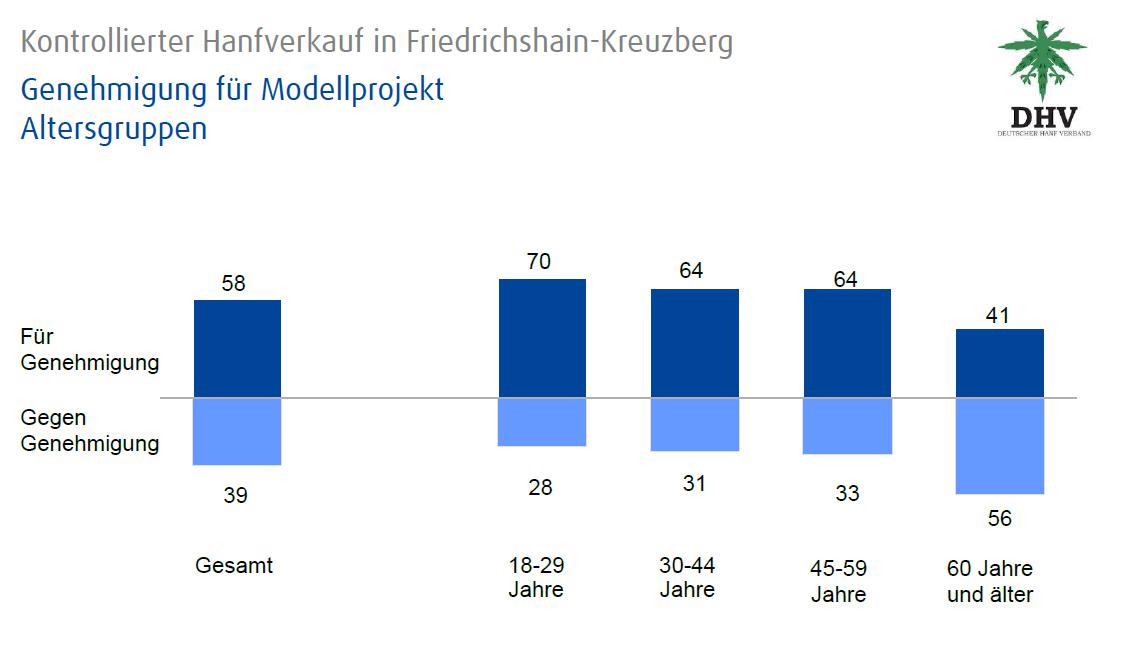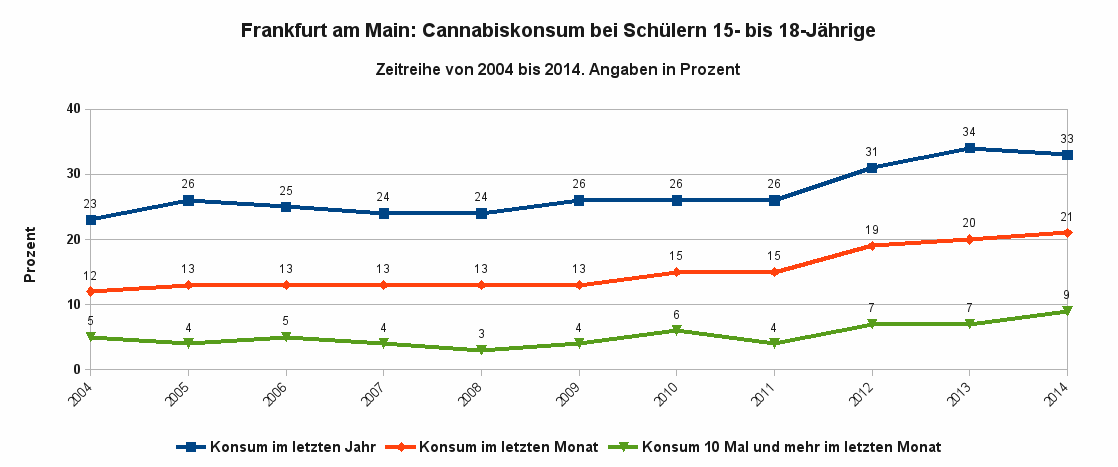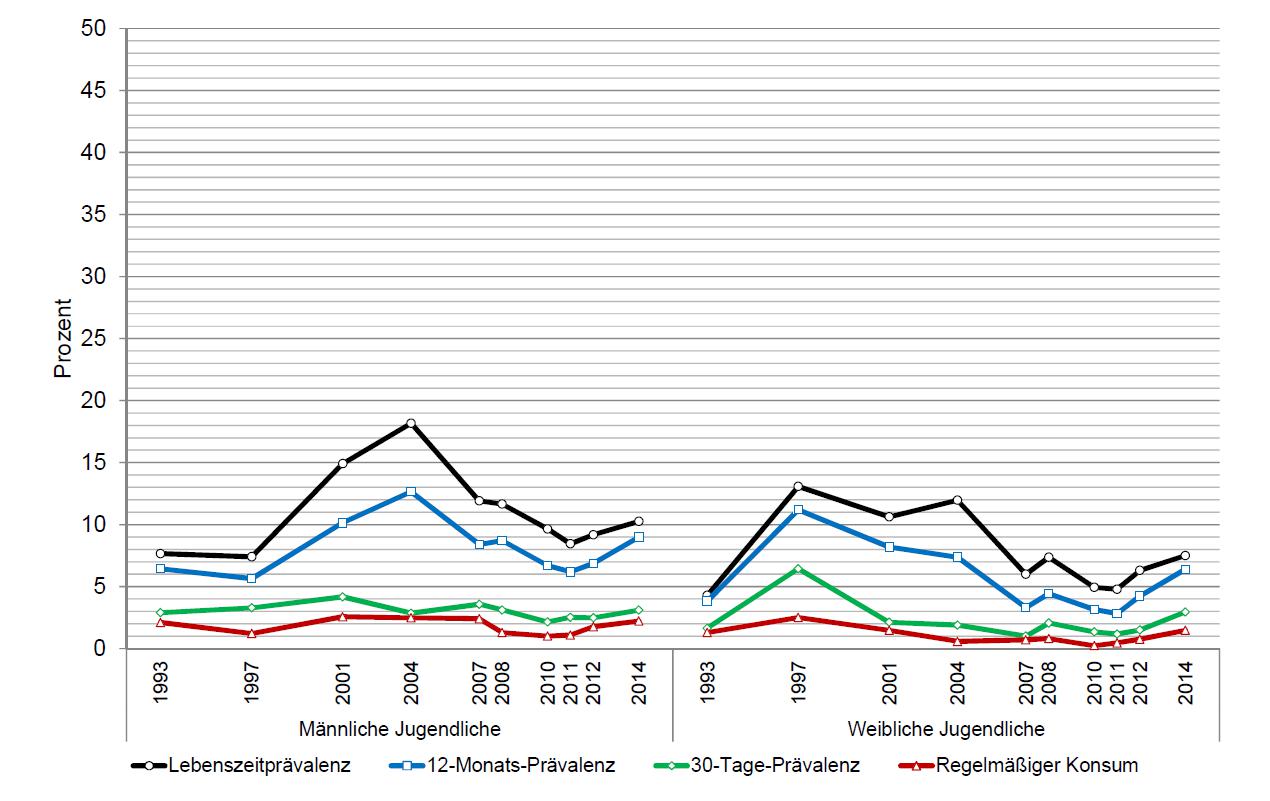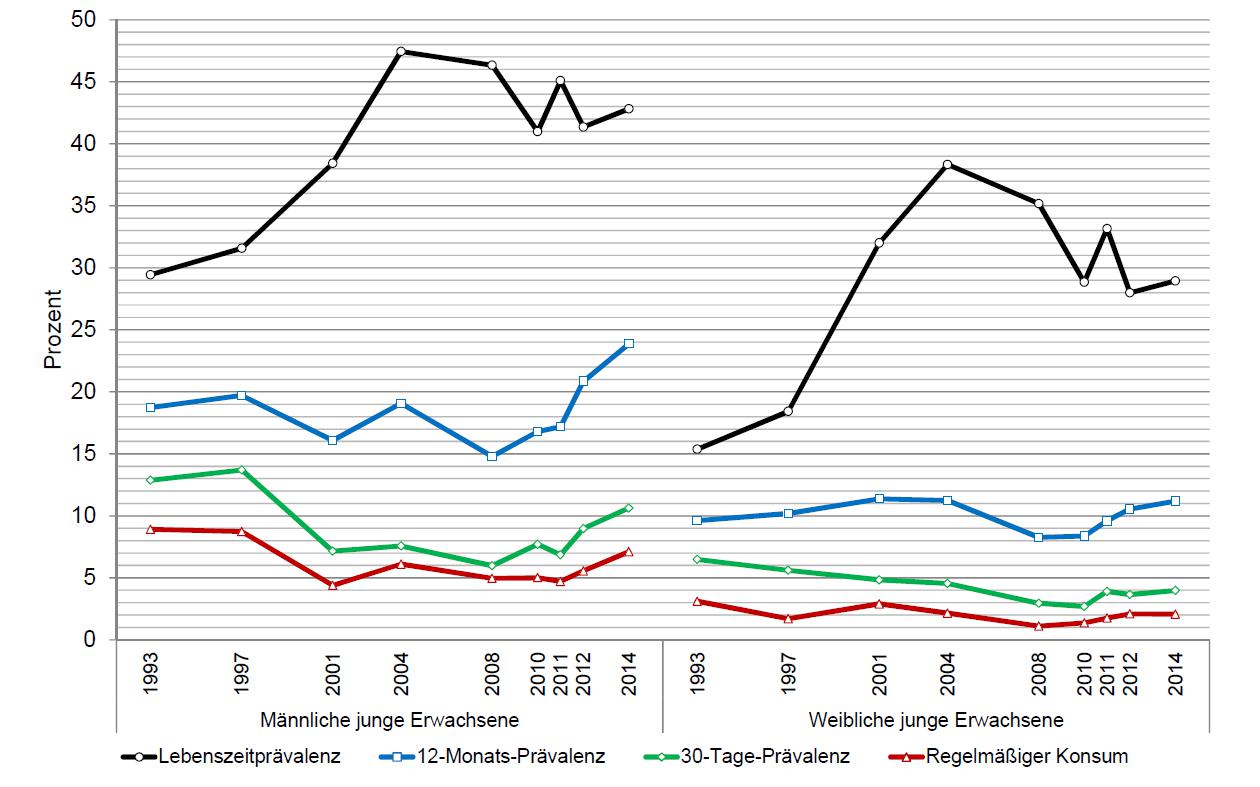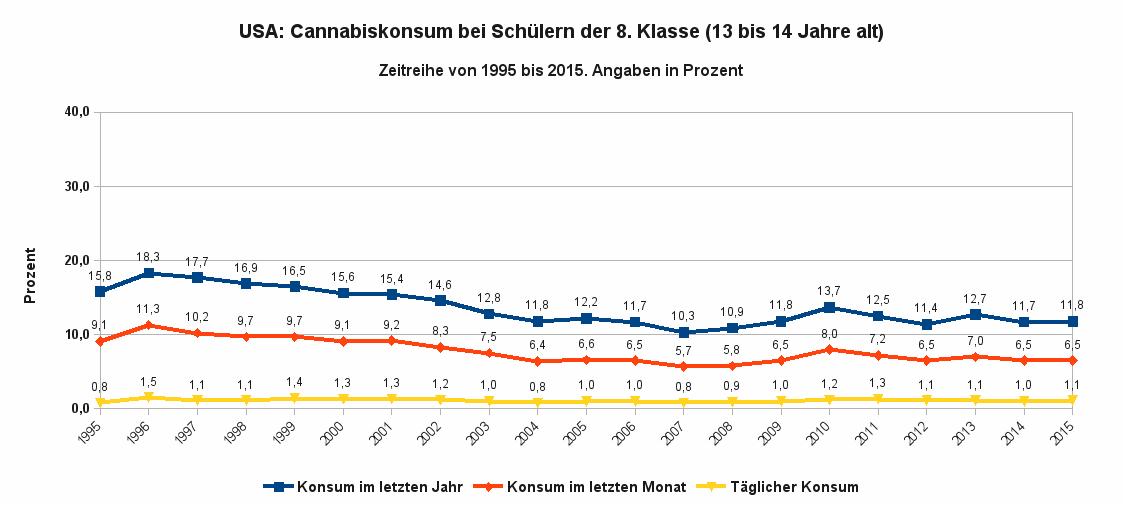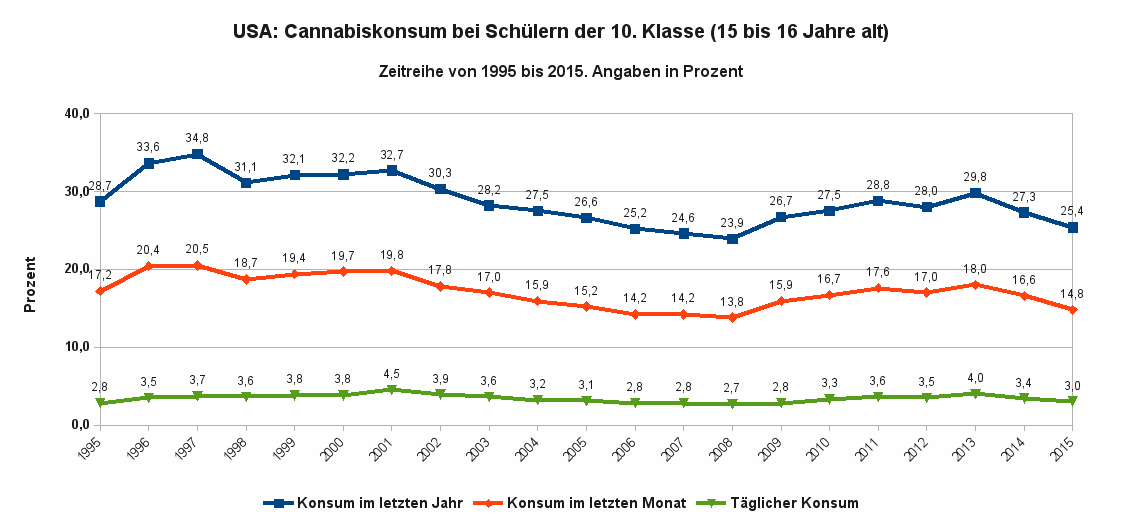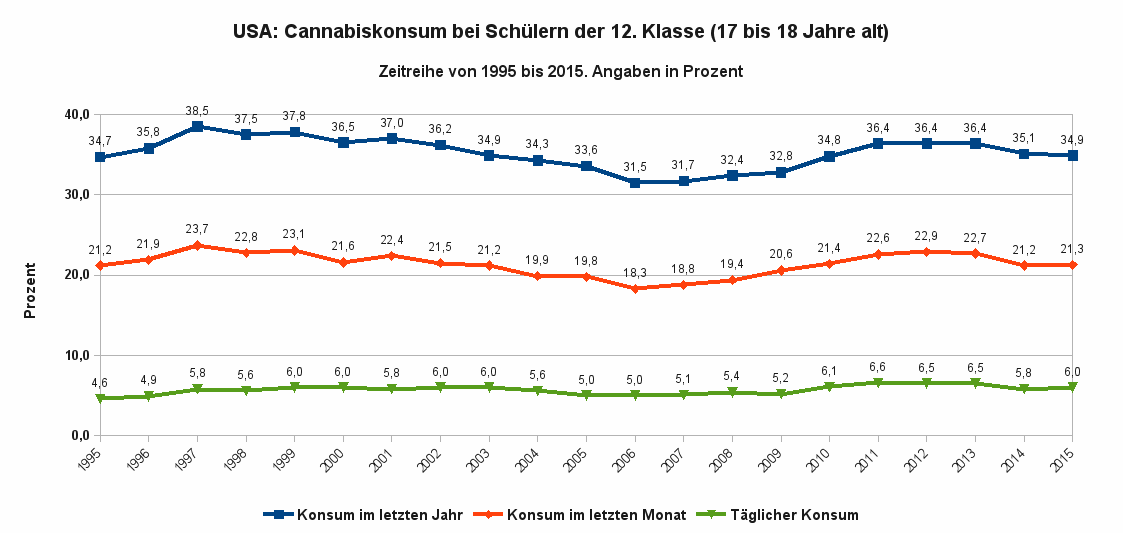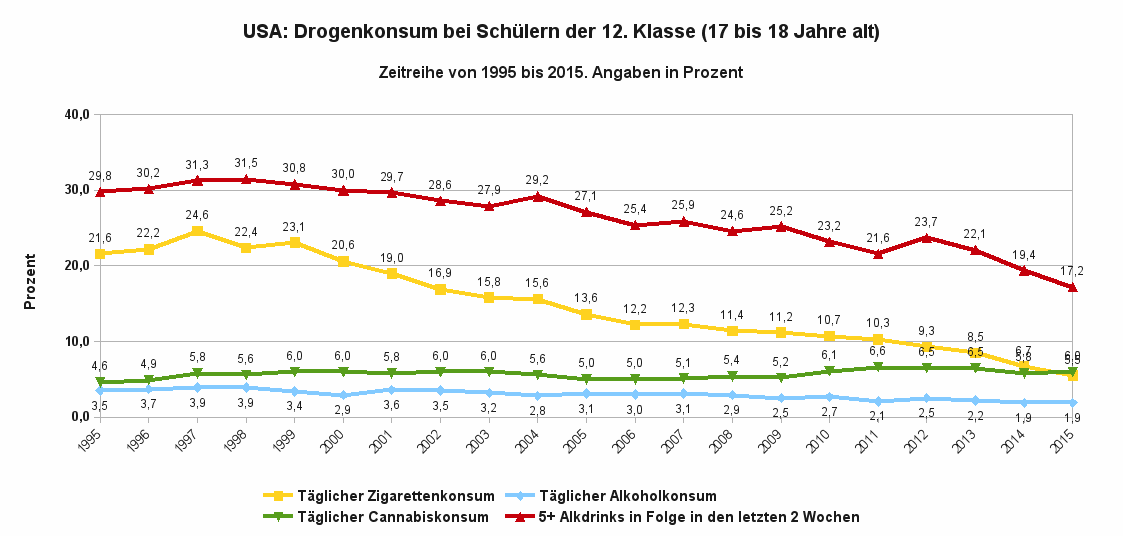Die Legalisierungsdebatte in Sachen Cannabis treibt die Repressionisten auf die Palme. Die Polizei intensiviert massiv die Jagd auf Kiffer. Im Jahr 2014 stieg die Anzahl der polizeilich registrierten Delikte wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 9,2%, bei den Delikten in Bezug auf Cannabis insgesamt um 11,2% und bei den allgemeinen Verstößen (auf den Konsum bezogene Delikte, Besitz kleiner Mengen zum Eigenverbrauch) in Bezug auf Cannabis um 11,7%. Von allen registrierten Delikte im Jahr 2014 in Bezug auf Cannabis entfielen 78,7% auf den Konsum bezogene Delikte. So hoch war dieser Anteil noch nie, dass heißt, noch nie zuvor wurden Kiffer so intensiv von der Polizei verfolgt wie im letzten Jahr.
Tatverdächtige
Bis 1966 lag die Zahl der jährlich erfassten Tatverdächtigen wegen Verstoßes gegen das Opiumgesetz in der Bundesrepublik Deutschland (einschliesslich West-Berlin) deutlich unter Eintausend. Erst 1967, dem Jahr in dem Benno Ohnesorg von der Polizei erschossen wurde, registrierten die Behörden über 1.000 Tatverdächtige. Vier Jahre später registrierten die Behörden bereits über 20.000 Tatverdächtige.
Ein Tatverdächtiger, für den im Berichtszeitraum mehrere Fälle der gleichen Straftat in einem Bundesland festgestellt wurden, wird nur einmal gezählt. Vor 1983 waren Personen, gegen die im Berichtsjahr mehrfach ermittelt wurde, immer wieder erneut gezählt worden. Wegen Ablösung dieser Mehrfachzählung, die zu stark überhöhten und strukturell verzerrten Tatverdächtigenzahlen führte, durch die jetzige “echte” Zählung, ist ein Vergleich zu früheren Jahren nur eingeschränkt möglich.
In den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts verdoppelte sich die Zahl der Tatverdächtigen und erreichte im Jahr 2004 mit 232.502 ihren absoluten Spitzenwert. Danach sank die Zahl kontinuierlich bis 2010 und danach stieg sie wieder kontinuierlich bis 2014 auf 228.110. Im Vergleich zum Vorjahr war eine Steigerung um 13,0% zu beobachten. Nur in den 70er Jahren sowie 1980, 1995 und 1996 wurden höhere Repressionsexpansionskoeffizienten, das heißt eine stärkere Zunahme der Repression gegen Drogengebraucher registriert.
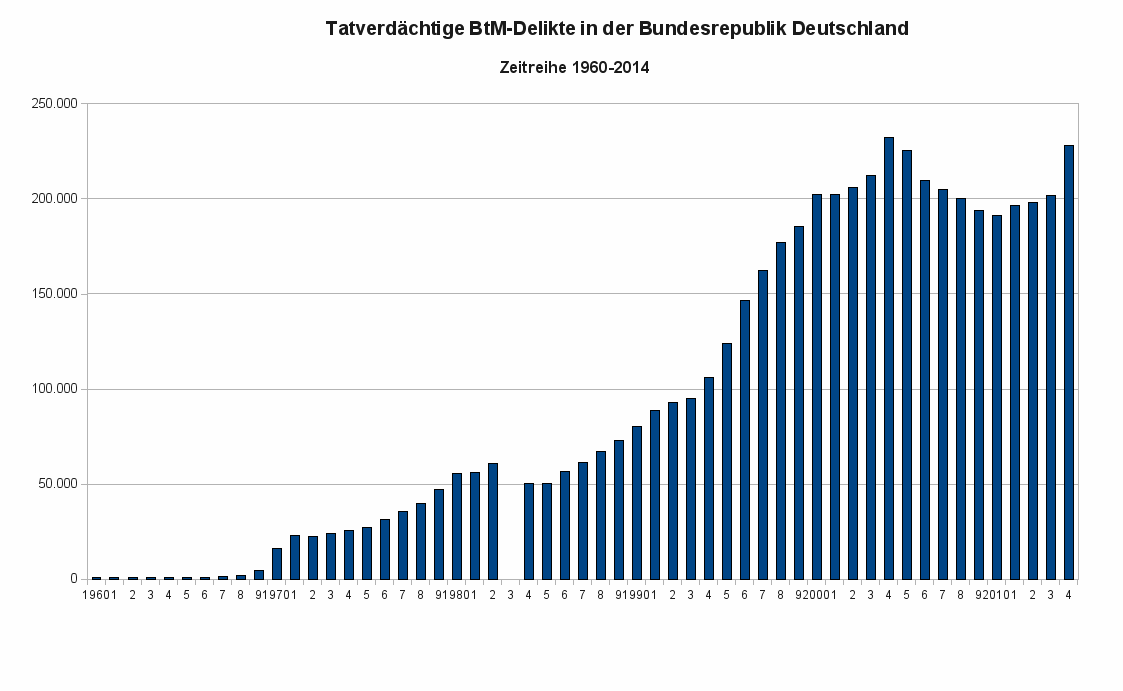 Abbildung 1 zeigt die Zeitreihe der Tatverdächtigen wegen Verstoßes gegen das BtMG von 1960 bis 2014.Wegen der Änderung des staatlichen Bereiches sind die Daten seit 1991 mit denen der Vorjahre nur bedingt vergleichbar. Die Zahlen bis 1990 beinhalten die Tatverdächtigen der alten Bundesländer einschließlich West-Berlin, die Zahlen der Jahre 1991 und 1992 beinhalten die Tatverdächtigen der alten Bundesländer einschließlich Gesamt-Berlin, in den Zahlen ab 1993 sind die Tatverdächtigen aller Bundesländer enthalten. Diese Angaben sind auch bei allen folgenden Abbildungen zu berücksichtigen. Datenquelle: BKA Wiesbaden.
Abbildung 1 zeigt die Zeitreihe der Tatverdächtigen wegen Verstoßes gegen das BtMG von 1960 bis 2014.Wegen der Änderung des staatlichen Bereiches sind die Daten seit 1991 mit denen der Vorjahre nur bedingt vergleichbar. Die Zahlen bis 1990 beinhalten die Tatverdächtigen der alten Bundesländer einschließlich West-Berlin, die Zahlen der Jahre 1991 und 1992 beinhalten die Tatverdächtigen der alten Bundesländer einschließlich Gesamt-Berlin, in den Zahlen ab 1993 sind die Tatverdächtigen aller Bundesländer enthalten. Diese Angaben sind auch bei allen folgenden Abbildungen zu berücksichtigen. Datenquelle: BKA Wiesbaden.
Jugendliche Tatverdächtige
In den Jahren von 1932 bis 1939 lag die Zahl der jährlich erfassten Rauschgiftvergehen insgesamt durchschnittlich bei 1.200 und es wurden durchschnittlich knapp 1.000 Tatverdächtige ermittelt. Der Anteil der Jugendlichen lag dabei zumeist deutlich unter 1% (1936: 0%; 1937: 0,2%). Zwischen 1956 und 1966 lag die Zahl der Tatverdächtigen wegen Verstoßes gegen das Opiumgesetz stets unter 1.000 und der Anteil der Minderjährigen (unter 18 Jahren) schwankte zwischen 0,3% und 1,7%. Durch die Instrumentalisierung des Opiumgesetzes zur Repression gegen die revoltierenden Studenten und Hippies im Jahr 1967 stieg der Anteil der minderjährigen Tatverdächtigen auf 29,4% an. Nach der Einführung des neuen Betäubungsmittelgesetzes im Winter 1971/72 sank der Anteil jugendlicher Tatverdächtiger wieder.
Noch deutlicher wird die Entwicklung bei der Betrachtung der heranwachsenden Tatverdächtigen. Waren im Jahr 1966 nur knapp 10% aller Tatverdächtigen unter 21 Jahre alt, so stieg dieser Anteil bis 1971 auf knapp 70% an. Nach der Einführung des neuen Betäubungsmittelgesetzes ist der Anteil junger Tatverdächtiger bis 1988 kontinuierlich zurückgegangen. Bei den unter 18jährigen lag er 1988 bei 4,8%. Nur 24,4% der Tatverdächtigen waren unter 21 Jahren alt.
In den 90er Jahren wurde das Betäubungsmittelgesetz, wenn auch nicht ganz so intensiv wie Ende der 60er, erneut instrumentalisiert, um eine aufkommende Jugendkultur in Schach zu halten und die an dieser Kultur partizipierenden Menschen einem intensiven Kontrollsystem zu unterwerfen. Im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends sanken die Anteile der jugendlichen und heranwachsenden Tatverdächtigen dann wieder um danach wieder anzusteigen.
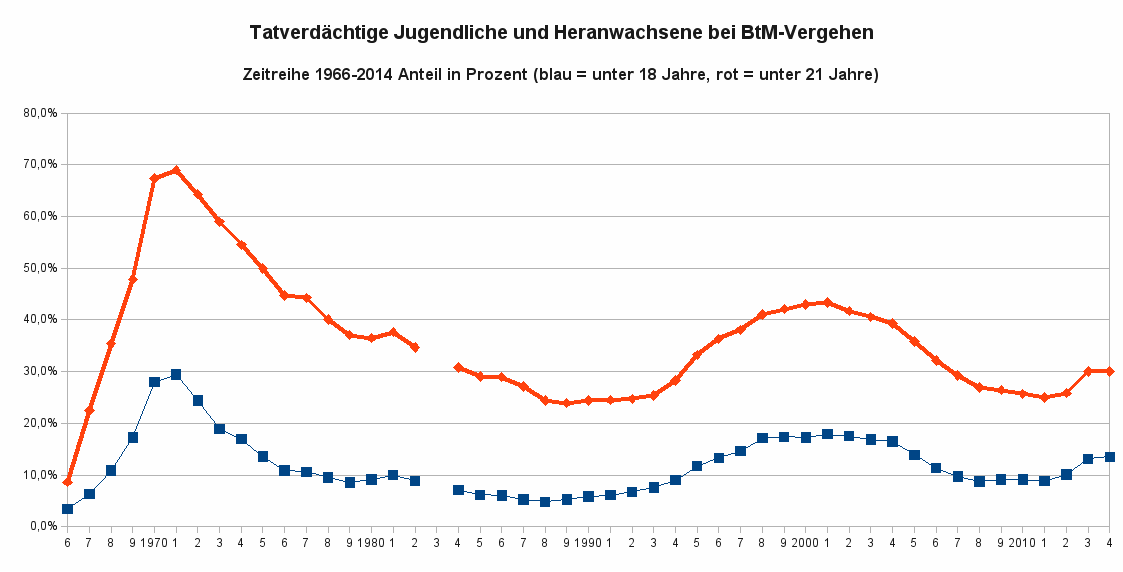 Abbildung 2 zeigt die Anteile in Prozent der jugendlichen und heranwachsenden Tatverdächtigen als Zeitreihe von 1966 bis 2014. Datenquelle: BKA Wiesbaden.
Abbildung 2 zeigt die Anteile in Prozent der jugendlichen und heranwachsenden Tatverdächtigen als Zeitreihe von 1966 bis 2014. Datenquelle: BKA Wiesbaden.
Allgemeine Verstöße
Als im Winter 1971/72 das neue Betäubungsmittelgesetz in Kraft trat, verkündete die Bundesregierung, dass mit dem Gesetz in erster Linie die Verfolgung der Drogenhändler und Drogenschmuggler beabsichtigt sei und erleichtert werden solle. Die Höchststrafe wurde zur Abschreckung von drei auf zehn Jahre heraufgesetzt. Am 1. Januar 1982 wurde nach einer Novellierung des Betäubungsmittelgesetzes die Höchststrafe von zehn auf 15 Jahre angehoben.
Obwohl mit dem BtMG in erster Linie Händler und Schmuggler verfolgt werden sollten, lag der Anteil der auf den Konsum bezogenen Delikte (allgemeine Verstöße gemäß §29 BtMG) nie unterhalb von 60 Prozent. Bis kurz nach der Jahrtausendwende schwankte der besagte Anteil stets zwischen 60 Prozent und 70 Prozent (einzige Ausnahme 1972), um dann im Jahr 2004 seit Jahrzehnten wieder die 70 Prozent Marke zu überschreiten. Im Jahr 2014 erreichte dieser Anteil den historischen Höchstwert von 75,7 Prozent. Die Repression gegen die Drogenkonsumenten hat im Jahr 2014 ein Rekordniveau erreicht.
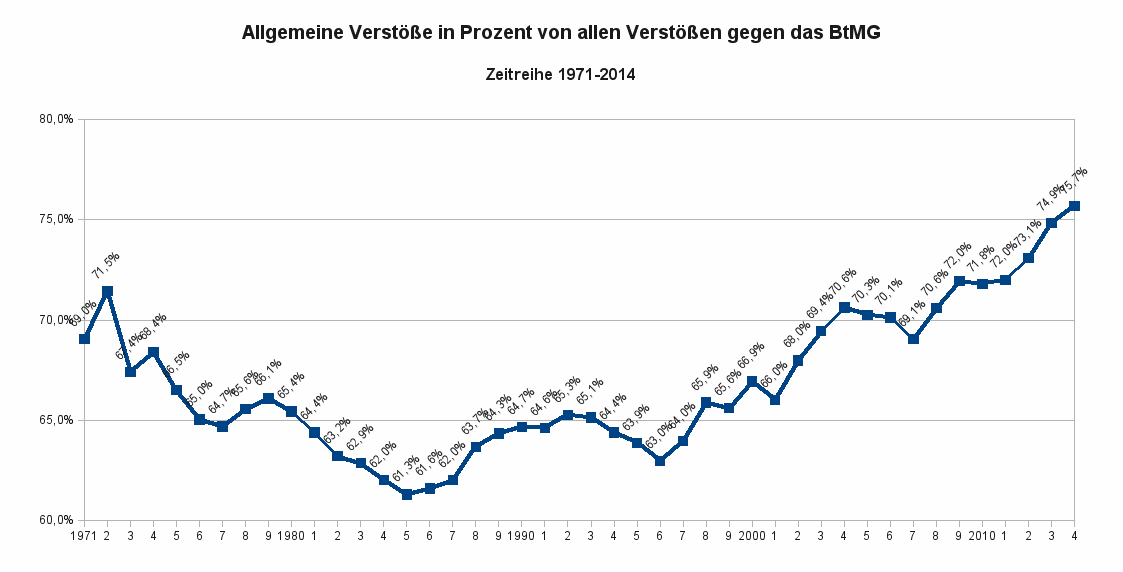 Abbildung 3 zeigt in Prozentwerten die Relation der allgemeinen Verstöße zu allen BtMG-Delikten als Zeitreihe von 1971 bis 2014. Datenquelle: BKA Wiesbaden.
Abbildung 3 zeigt in Prozentwerten die Relation der allgemeinen Verstöße zu allen BtMG-Delikten als Zeitreihe von 1971 bis 2014. Datenquelle: BKA Wiesbaden.
Anteile der diversen Cannabisdelikte
In den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts lag der Anteil der allgemeinen Verstöße bei den Cannabisdelikten bei 65% und der Anteil bezüglich Handel und Schmuggel bei etwas über 30%. In der Folge stieg der Anteil der allgemeinen Verstöße nahezu kontinuierlich und der Anteil bezüglich Handel und Schmugel sank hingegen nahezu kontinuierlich. Im letzten Jahr erreichte der Anteil der allgemeinen Verstöße den Spitzenwert von 78,7% und der Anteil bezüglich Handel und Schmuggel den tiefsten Wert aller Zeiten mit 17,6%.
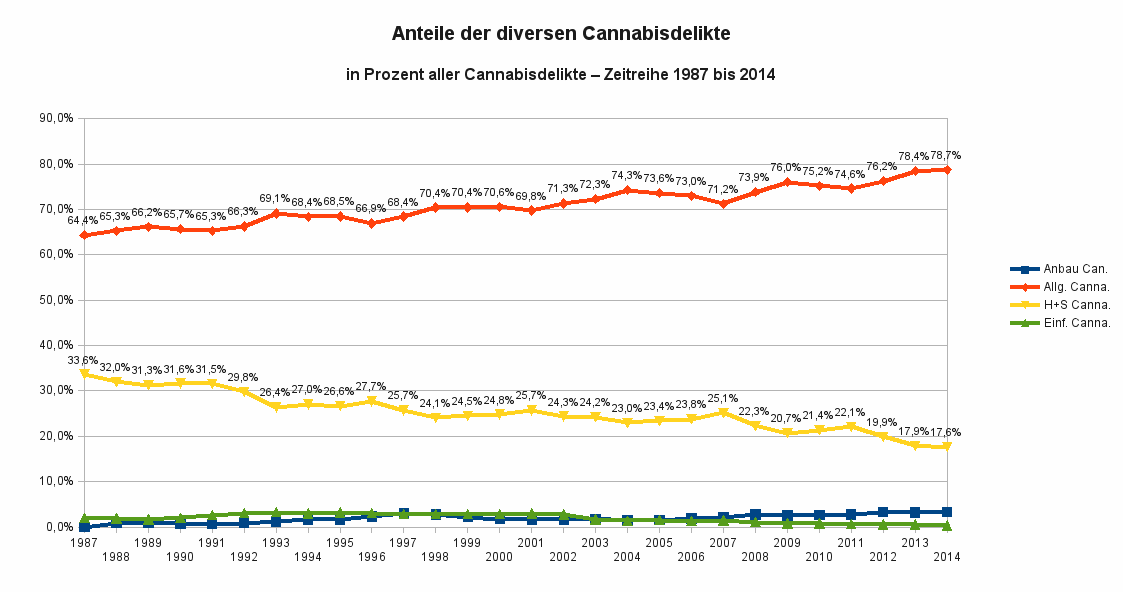 Abbildung 4 zeigt die Anteile der diversen Cannabisdelikte als Zeitreihe von 1987 bis 2014. Der illegale Anbau erreichte 2014 einen Anteil von 3,3% und die illegale Einfuhr in nicht geringen Mengen einen Anteil von 0,4%. Datenquelle: BKA Wiesbaden.
Abbildung 4 zeigt die Anteile der diversen Cannabisdelikte als Zeitreihe von 1987 bis 2014. Der illegale Anbau erreichte 2014 einen Anteil von 3,3% und die illegale Einfuhr in nicht geringen Mengen einen Anteil von 0,4%. Datenquelle: BKA Wiesbaden.